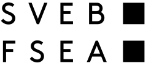Die Anliegen, mit denen die eduQua-Geschäftsstelle konfrontiert wird, können ins Detail gehen. Der zweite, ausführlichere Teil zu den Fragen und Antworten rund um eduQua.
Dürfen zertifizierte Institutionen das eduQua-Logo überall verwenden?
Das eduQua-Logo ist markenrechtlich geschützt und deshalb gelten definierte Nutzungsbestimmungen. Diese schreiben unter anderem vor, dass das eduQua-Logo nicht zur Kennzeichnung einzelner Bildungsgänge und nicht auf Diplomen, Zertifikaten, Teilnahmebestätigungen und ähnlichen Dokumenten verwendet werden darf. eduQua zeichnet die Institution aus und nicht ihre Bildungsangebote und Abschlüsse, deshalb muss das Logo so eingesetzt werden, dass es im Sinne einer transparenten Kommunikation zu keinen Missverständnissen bezüglich der Aussage oder des Gültigkeitsbereichs der eduQua-Zertifizierung kommt. Wo das Logo nicht erlaubt ist, dürfen zertifizierte Anbieter jedoch erwähnen, dass ihre Institution bzw. Weiterbildungsabteilung eduQua-zertifiziert ist (vgl. Wegleitung, Kap. 6.1 eduQua Qualitätslabel Verwendung).
Was ist der Unterschied zwischen einer eduQua- und einer ISO-Zertifizierung?
Beide sind Qualitätsmanagementsystem-Normen für Bildungsorganisationen. Ein grosser Unterschied besteht darin, dass eduQua auf Schweizer Weiterbildungsinstitutionen ausgerichtet ist, wohingegen ISO 21001 ein internationaler Standard ist, der Bildungsorganisationen auf allen Stufen im Fokus hat. Wie bei ISO steht bei eduQua die systematische Qualitätsentwicklung nach dem PDCA-Zyklus im Zentrum. eduQua ist stark an ISO 9001 angelehnt, vor allem was das Zertifizierungsverfahren angeht. Es ist somit auch möglich, eduQua mit einer ISO 90001 und/oder ISO 21001 Zertifizierung zu kombinieren. Bezüglich Dokumentation und Kosten ist eine ISO-Zertifizierung aufwändiger und kostenintensiver als eduQua:2021. Daher eignet sich eduQua auch für kleine Weiterbildungsanbieter, und das Label hat sich bei Schweizer Behörden als Grundvoraussetzung für Fördergelder etabliert.
Ist eine eduQua-Zertifizierung nur für mittel- bis grosse Weiterbildungsanbieter sinnvoll und machbar?
eduQua ist nicht nur ein Label, sondern auch ein Qualitätsmanagementsystem (QMS), und die eduQua:2021-Qualitätsnorm lehnt sich stark an ISO 9001 an. Ausserdem dürfen nur von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS akkreditierte Zertifizierungsstellen die Zertifizierung vornehmen. Aus diesen Gründen sind die Struktur, Prozesse und Beurteilungskriterien klar vorgegeben und werden vor allem von kleinen Weiterbildungsanbietern als sehr statisch und ausgerichtet auf grosse Organisationen wahrgenommen. Tatsächlich gibt es aber Mechanismen, welche die Eigenschaften einer Institution sowie deren Grösse beziehungsweise Volumen an Weiterbildungsangeboten berücksichtigen, beispielsweise die Unterscheidung in Verfahren A, B und C oder die flexible Auslegung der Anforderung «interne Überprüfungen». Trotz des anspruchsvollen Initialaufwands in Bezug auf die Dokumentation und den Aufbau eines QMS, ist die eduQua-Zertifizierung auch für Kleinstanbieter umsetzbar und im Vergleich zu ISO 21001 kostengünstiger und praxisorientierter.
Kann ein neuer Anbieter sofort die eduQua-Zertifizierung beantragen?
Eine eduQua-Zertifizierung steht grundsätzlich allen Institutionen offen, die Weiterbildung für Erwachsene im Schweizer Weiterbildungsmarkt anbieten und ihre Qualität ausweisen und verbessern wollen. Es müssen aber die Grundvoraussetzungen erfüllt sein, die im eduQua-Reglement unter Kapitel 3.2 beschrieben sind. Dabei gilt als Mindestvoraussetzung, dass die Weiterbildungsinstitution bereits Praxis als Bildungsanbieter aufweist und zum Zeitpunkt der Zertifizierung nachweislich mindestens ein Weiterbildungsangebot durchgeführt und gemäss den eduQua-Kriterien evaluiert worden ist.
Müssen alle Ausbildenden und Lernbegleitenden einer Weiterbildungsinstitution ein SVEB-Zertifikat haben, damit die eduQua-Kriterien erfüllt sind?
Das Kriterium C1 der eduQua:2021 Norm beschreibt, dass das eingesetzte interne und externe Weiterbildungspersonal fachliche sowie erwachsenenbildnerische Anforderungen erfüllt und deshalb relevante Qualifikationen und Erfahrung vorweisen muss. Als Anforderung gilt, dass bei der Erstzertifizierung mindestens eine Person bzw. 10 Prozent der Ausbildenden und Lernbegleitenden über ein SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder oder eine analoge Qualifikation verfügen. Bei der Rezertifizierung (nach Ablauf des 3-Jahres-Zyklus) müssen 80 Prozent der Ausbildenden und Lernbegleitenden diese Anforderung erfüllen. Sie gilt für Ausbildende und Lernbegleitende, die ein Pensum von mehr als 150 Stunden Ausbildungstätigkeit oder Lernbegleitung pro Jahr aufweisen. Alle, die ein Jahrespensum von maximal 150 Stunden haben sowie Weiterbildungspersonal, das keine erwachsenenbildnerische Qualifikation hat, müssen bei der Gestaltung und Ausübung von Lernangeboten durch Personen begleitet werden, die in der Erwachsenenbildung mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis Ausbilderin/Ausbilder qualifiziert sind (vgl. eduQua:2021 Qualitätsnorm Kriterium C1).
Was bedeutet eine «analoge Qualifikation» zum SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder?
Eine analoge Qualifikation zum SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder erfüllt folgende Anforderungen:
– In den besuchten Aus- und Weiterbildungen wurden vergleichbare Kompetenzen zu denjenigen in den Modulen zu einem SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder erworben.
– Besuchte Aus- und Weiterbildungen im Bereich Bildung müssen sich zu einem relevanten Teil auf das Lernen und Lehren mit Erwachsenen beziehen.
– Der Umfang der Lernzeit ist vergleichbar zu den Modulen, die zum SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder führen, also rund 400 Lernstunden inklusive Praxis.
– Die Betreffenden müssen eine Ausbildungspraxis von mindestens 150 Stunden verteilt über mindestens zwei Jahre vorweisen (vgl. eduQua Wegleitung S. 21 ff.).
Weder eduQua noch der SVEB sehen eine institutionelle Gleichwertigkeit vor, ebenfalls macht die eduQua Geschäftsstelle keine Analogbewertungen. Beim SVEB gibt es aber die Möglichkeit der Gleichwertigkeitsbeurteilung von Kompetenzen, die Anstelle eines Kursbesuchs zur Erlangung des SVEB-Zertifikats Ausbilderin/Ausbilder führen kann.
Wie kann ein Weiterbildungsanbieter nachweisen, dass die eduQua-Anforderungen an Ausbildende und Lernbegleitende erfüllt sind, wenn keine SVEB-Zertifikate vorhanden sind und analoge Qualifikationen vorgewiesen werden müssen?
Im Kriterium C1 werden als Nachweisdokumente die Anforderungsprofile mit den geforderten fachlichen und erwachsenenbildnerischen Anforderungen an das Weiterbildungspersonal sowie eine Liste aller internen und externen Ausbildenden und Lernbegleitenden verlangt. Die Liste soll das Weiterbildungspersonal nach dem Umfang des Pensums (1-150 Std. und > 150 Std. pro Jahr) unterteilen und dessen Qualifikationen sowie Praxiserfahrung aufzeigen. Ebenfalls sollen Begleitpersonen aufgeführt werden, die erwachsenenbildnerisch mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis Ausbilderin/Ausbilder qualifiziert sind und die Personen mit kleinen Pensen und ohne geforderte Qualifikation bei der Ausbildungstätigkeit begleiten (vgl. Wegleitung, S. 21 ff.). Bei Ausbildenden und Lernbegleitenden, die mehr als 150 Stunden pro Jahr aufweisen, aber kein SVEB-Zertifikat haben, soll zusätzlich eine Gegenüberstellung gemacht werden. Die in der als «analog» betrachteten Aus-/Weiterbildung erarbeiteten Kompetenzen, Lerninhalte, Lernzeiten und anschliessenden Praxisstunden sollen mit denjenigen der Modulbeschreibung des SVEB-Zertifikats Ausbilderin/Ausbilder verglichen werden, um eine analoge Qualifikation zum SVEB-Zertifikat Ausbilderin/Ausbilder nachweisen zu können. Die Auditor/innen überprüfen beim Audit, ob die als «analog» nachgewiesenen Qualifikationen und Kompetenzen die Anforderungen im Kriterium C1 erfüllen.
Bei Ausbildenden und Lernbegleitenden, die wenig formale Qualifikationen aber viel Erfahrung in der Erwachsenenbildung aufweisen, kann die Institution mit Hilfe des Formulars «Analogbewertung» zusätzlich zur Gegenüberstellung der Kompetenzen und Lerninhalte eine Praxisdemonstration bewerten und die Evaluation als Nachweis für eine analoge Qualifikation einreichen. Wenn es einer Institution schwerfällt, analoge Qualifikationen nachzuweisen, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass ihre Ausbildenden und Lernbegleitenden einen SVEB-Kurs absolvieren (für bestimmte Qualifikationen wie z.B. Lehrpersonen mit EDK-anerkanntem Lehrdiplom gibt es verkürzte Modulangebote) oder eine offizielle Gleichwertigkeitsbeurteilung durchlaufen, die bei erfolgreicher Überprüfung der Kompetenzen auch ohne Kurs zu einem SVEB-Zertifikat führt.