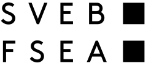Menschen in prekären Verhältnissen haben kaum Zugang zu Aus- und Weiterbildung, obwohl sie diese nötig hätten, um sich aus der Armut zu befreien. Caritas Schweiz formuliert darum in einem Positionspapier sechs konkrete Forderungen.
Bildung spiele in der heutigen Wissensgesellschaft eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Armut, schreibt Caritas Schweiz im Positionspapier. Sie eröffne nicht nur neue berufliche Perspektiven, sondern ermögliche auch ein selbstbestimmtes Leben. Zumal formale Bildungsabschlüsse und Zertifikate entscheidende Kriterien auf dem Arbeitsmarkt sind. Ohne diese Qualifikationen sind die Berufsmöglichkeiten stark begrenzt.
Doch gerade Erwachsenen mit geringen Einkommen bleibe die Chance auf lebenslanges Lernen vielfach verwehrt, weil die Bildungspläne nicht mit ihrer Lebensrealität vereinbar sei. Unter den 336‘000 Working Poor in der Schweiz sind Beschäftigte ohne nachobligatorische Bildung übervertreten.
Ungleichheiten verstärken sich
Doch je tiefer das Erwerbseinkommen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit auf Weiterbildung. Wer hoch qualifiziert ist und gut verdient, nimmt viel öfter an Weiterbildung teil, als wer wenig ausgebildet ist und wenig verdient. Diese Diskrepanz ist in der Schweiz sehr ausgeprägt.
So verstärken Weiterbildungen im Erwachsenenalter jedoch Bildung- und Einkommensungleichkeiten, schreibt die Caritas. Menschen mit geringem Bildungsniveau und niedrigem Einkommen bleiben in ihrem sozialen Status gefangen und die soziale Kluft nehme zu.
Obwohl gezielte Massnahmen helfen, wie z.B. Bildungsgutscheine oder zielgerichtete Weiterbildungen im Betrieb via «Einfach besser!… am Arbeitsplatz», bleiben gemäss Caritas noch zu viele Menschen mit knappem Budget von Weiterbildung ausgeschlossen.
Strukturelle Gründe
Die Organisation macht dafür vier strukturelle Gründe verantwortlich:
- Ungleiche Startchancen wirken sich auf die gesamte Bildungsbiografie aus.
- Mangelnde Grundkompetenzen werden unterschätzt und die betroffenen Menschen müssen besser erreicht werden.
- Der Bildungswunsch ist nicht vereinbar mit der Lebensrealität: Die Mehrfachbelastung verunmöglicht Aus- und Weiterbildungen.
- Eine systematische Finanzierung von Aus- und Weiterbildung fehlt.
Besonders für Alleinerziehende oder Eltern mit Betreuungspflichten, Personen mit Migrationshintergrund und ältere Personen sei der Zugang zu Aus- und Weiterbildungen erschwert.
Sechs Forderungen
Aufgrund dessen formuliert Caritas sechs konkrete Forderungen, um Menschen in prekären Lebenssituationen lebenslanges Lernen zu ermöglichen:
- Das Bildungssystem müsse chancengerecht reformiert werden: Es brauche einen frühen Schuleintritt und eine späte Selektion.
- Die Schweiz müsse eine existenzsichernde Finanzierung für Aus- und Weiterbildung garantieren, etwa mit Stipendien während der Aus- oder Weiterbildung.
- Bildungszugänge für Eltern sind durch kostengünstige Kinderbetreuung zu sichern.
- Validierungsverfahren zur Anerkennung von Bildungsleistungen sind auszubauen.
- Arbeitgeber sollen Weiterbildung aktiv fördern.
- Bund und Kantone sollen bedarfsgerechte Bildungsangebote bereitstellen, die der Lebensrealität der potenziellen Teilnehmenden entsprechen, wie z.B. Teilzeitlehrstellen, Modulare Kursangebote, hybride Weiterbildungskurse oder Lernstuben.