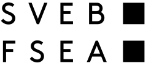In der Schweiz verfügen rund 30 Prozent der Erwachsenen über geringe Grundkompetenzen. Doch nur wenige von ihnen nehmen an Weiterbildungsmassnahmen zur Förderung dieser Kompetenzen teil. Eine neue Studie des SVEB geht der Frage nach, weshalb das so ist und was die Weiterbildung dagegen tun kann.
Warum besuchen Menschen mit geringen Grundkompetenzen keine Weiterbildung? Dieser Frage ging der SVEB in der qualitativen Studie «Subjektive Sichtweisen auf Grundkompetenzen: Gründe für eine Nicht-Teilnahme an Angeboten» nach. Dazu wurden qualitative Interviews mit 20 Erwachsenen durchgeführt, die über geringe Grundkompetenzen verfügen und in den letzten Jahren nicht an einem Weiterbildungsangebot teilgenommen haben. Im Zentrum der Forschungsperspektive standen das alltägliche Erleben und der Umgang mit Grundkompetenzanforderungen.
Die Ergebnisse zeigen: Viele Befragte finden sich trotz geringer Grundkompetenzen in ihrem Alltag gut zurecht und entwickeln individuelle Strategien, um mit den Anforderungen umzugehen. Lernen in einem strukturierten Setting erscheint ihnen in ihrem funktionierenden Alltag oft als nicht notwendig oder sogar als unpassende Zumutung.
Geringe Grundkompetenzen bedeuten für die Betroffenen jedoch auch, dass ihr Alltag anstrengend ist und sie gesellschaftliche Erwartungen oftmals nicht erfüllen können. Viele erleben das Gefühl des «Nicht-Genügens» und berichten von negativen, teilweise verinnerlichten Zuschreibungen. Diese Defizitwahrnehmung schwächt das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit und kann eine Hürde für Weiterbildung darstellen.
Gleichzeitig zeigen einige Interviews auch, dass manche Personen die gängigen gesellschaftliche Normen und Erwartungen hinterfragen und sich bewusst jenseits davon positionieren. Nicht-Teilnahme ist in diesen Fällen kein Rückzug, sondern Ausdruck eines Widerstands.
Was bedeutet das für die Weiterbildung?
Die Studie liefert Hinweise, wie Weiterbildungsangebote anschlussfähiger gestaltet werden können. Im Zentrum steht eine stärkere Orientierung an der Lebenswelt der Zielgruppen und die Anknüpfung der Weiterbildungsangebote an alltägliche Herausforderungen und Interessen. Auch niederschwellige und partizipativ entwickelte Formate, sowie solche, die an der Schnittstelle zwischen strukturiertem und nicht strukturiertem Lernen angesiedelt sind, gewinnen an Bedeutung. Wichtig erscheinen zudem Ansprachestrategien und Unterstützungsangebote, welche nicht mit defizitorientierten Zuschreibungen einhergehen. Insgesamt braucht es angesichts der Heterogenität der Zielgruppe eine grosse Angebotsvielfalt.
Darüber hinaus zeigt die Studie: Der Umgang mit Grundkompetenzen ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Erwartungen bezüglich Grundkompetenzen und das damit verbundene Normverständnis können zu Ausgrenzungen führen. Die Forschungsergebnisse laden dazu ein, über neue Wege in der Förderung von Grundkompetenzen nachzudenken.
Der SVEB präsentiert die zentralen Ergebnisse des Forschungsberichts am 21. Oktober 2025 von 14.00 bis 15.00 Uhr in einer Online-Veranstaltung und stellt sie zur Diskussion. Nach einem Input durch das Forschungsteam reflektieren Gäste aus Praxis und Wissenschaft die Resultate.