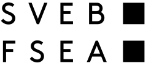Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift «weiter bilden» setzt sich mit KI in der Weiterbildung auseinander. In einem Interview bilanzieren zwei Wissenschaftlerinnen: KI ermächtigt viele Lernende. Die grosse Sprengkraft der KI in der Weiterbildung berge aber die Tatsache, dass diese mit der eigenen Sprache gesteuert wird.
Die Zeitschrift «weiter bilden» des Deutschen Instituts für Weiterbildung widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe der generativen künstlichen Intelligenz in der Weiterbildung. Die Ausgabe beleuchtet, welche Möglichkeiten sich mit generativen KI-Modellen eröffnen, und wie sich diese auf die (Erwachsenen-)Bildung auswirken.
Dr. Anne Strauch und Susanne Lattke, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen, skizzieren den Einsatz von KI in der Erwachsenenbildung auf drei Ebenen:
- Makro-Ebene: System
Hier könne KI etwa helfen, grosse Weiterbildungs-Datenbanken zu erstellen und zu verwalten, Trends zu analysieren und gezielte Förderprogramme zu entwickeln, die benachteiligte Gruppen unterstützen. - Meso-Ebene: Unternehmen
Auf dieser Ebene können durch KI Verwaltungsprozesse automatisiert werden, sei es bei der Kursanmeldung, der Kommunikation mit (potenziellen) Teilnehmenden oder in der Weiterbildungsberatung. Routineaufgaben wie die Erstellung von Programmtexten oder das Recruiting von Dozierenden könnten dadurch effizienter und kostengünstiger gestaltet werden. - Mikro-Ebene: Individuen
Auf dieser Ebene geht es vor allem um die Personalisierung des Lernprozesses: «Lernende können auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Inhalte und Lernpfade erhalten, die durch KI analysiert und angepasst werden. Auch für Lehrende können KI-gestützte Lernmanagementsysteme eine erhebliche Erleichterung darstellen, da sie beispielsweise den Lernfortschritt überwachen und automatisiert Rückmeldungen geben können.»
KI mit grossem Disruptionspotenzial
In einem Interview mit den Sprachwissenschaftlerin Dr. Sonya Dase und der Soziologin Christiane Carstensen, die sich in einer gemeinsamen Denkfabrik mit der Zukunft des Lernens, Sprache & KI beschäftigen, steht die Sprache im Zentrum.
Bevor man frage, welche Kompetenzen gebraucht werden, um KI in der Erwachsenenbildung sinnvoll nutzen zu können, müsse man wahrnehmen, wie stark die KI die Erwachsenenbildung verändern werde, finden die beiden. Wer sich bei der Konzeption pädagogischer Inhalte ausschliesslich auf Tools wie ChatGPt verlasse, laufe Gefahr, sehr rasch auf eindimensionale Bildungsbilder hereinzufallen.
Dies, weil KI Bildungsdiskurse nicht neutral abbilde, sondern stark von technologischen Leitmotiven wie Effizienz, Steuerbarkeit und Automatisierung geprägt sei. KI könne zudem nur alte Muster widerspiegeln und konzentriere sich meist darauf, «das, was schon immer gemacht wurde, besser zu machen oder den Prozess zu vereinfachen».
«Was für die Bildung wirklich Sprengkraft besitzt, ist die Tatsache, dass das Betriebsmittel der KI die eigene Sprache ist. Und das wird unseres Erachtens nicht ausreichend wahrgenommen», sagt Carstensen im Interview. «Ich befrage die KI mit meinem Kenntnisstand, meinem Erkenntnisinteresse und mit meiner natürlichen Sprache zu einem Gegenstand oder einem Wissensbereich.» Die KI passe sich dem Benutzer an und habe mittlerweile eine hohe Kontextsensibilität.
Selbstermächtigung dank immer verfügbarer Unterstützung
Dadurch finde eine grosse Selbstermächtigung der Lernenden statt, die sich oftmals gar nicht als Lernende begreifen, sondern auf der Suche nach Lösungen für konkrete Probleme seien. Und auf diese Weise oft gar keine (Weiter-)Bildungsangebote mehr besuchen.
Die künstliche Intelligenz sei eine Informationsbeschafferin und Helferin, die jederzeit und überall zur Verfügung stehe, der Benutzerin stets die volle Aufmerksamkeit schenke und nicht urteile. Dies können Vorteile gegenüber traditionellen Bildungsangeboten sein, so Dase und Carstensen, zumal beispielsweise Scham ein grosses Thema sein könne.
Die Expertinnen glauben zudem, dass sich durch KI die Zielgruppenorientierung der Weiterbildung abschwächen und Sprachgrenzen auflösen könnten.
Die ausführlichen Texte lesen Sie hier.