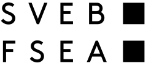In Zeiten von raschen Transformationsprozessen und Fachkräftemangel ist es nötig, dass nicht formal erworbene Fähigkeiten digital nachweisbar sind. Können das Open Badges, Micro-Credentials und Data Wallets gewährleisten?
Der gesellschaftliche Wandel und der technologische Fortschritt verändern den Arbeitsmarkt und fordern von den Arbeitnehmenden neue Kompetenzen und insofern eine gute Anpassungsfähigkeit. Mit neuen Anforderungen und Qualifikationen wird aber auch eine entsprechende Anerkennung wichtig. Die rasche Entwicklung verlangt auch hier eine gewisse Flexibilität und die Frage stellt sich, wie ein individuelles Kompetenzprofil ausgewiesen werden kann.
In diesem Zusammenhang werden oft digitale Tools wie Micro-Credentials, Open Badges oder Data-Wallets genannt. In einem Beitrag des Fachmagazins weiter bilden des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) werden diese drei Konzepte genauer betrachtet.
Gerade Menschen, die über keine Abschlüsse in Papierform verfügen, könnten davon profitieren, heisst es im Artikel. «Angesichts des Fachkräftemangels sowie bei Berufsgruppen, die auf Quereinsteigende angewiesen sind, erhöht sich der Bedarf nach spezifischen Kompetenznachweisen», schreibt die Autorin Ilona Buchem, Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Berliner Hochschule für Technik. Auch die «Vernetzung und Durchlässigkeit von immer stärker globalisierten Bildungssystemen und Arbeitsmärkten» begünstige flexiblere Formen von digitalen Kompetenznachweisen.
Diesbezüglich haben Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsanbieter nicht mit der raschen Entwicklung Schritt halten können: Die Art und Weise, wie Kompetenzen ausgewiesen werden, hat sich bisher wenig verändert. Digitale Kompetenznachweise könnten also diesbezüglich einen klaren Mehrwert generieren.
Micro-Credentials: flexible Häppchen
Micro-Credentials, also kurze Lerneinheiten und ihre Nachweise, werden in Bezug auf das lebenslange Lernen immer wieder genannt und sind auch Teil der EU-Strategie für Beschäftigungsfähigkeit. Sie sollen etwa flexible Lernwege ermöglichen. «Zu den zentralen Herausforderungen gehören die notwendige Verständigung auf Mindestanforderungen, Qualitätskriterien für die Anerkennung und Anrechnung hochschulischer und ausserhochschulischer Angebote, Anpassung bestehender Instrumente der Qualitätssicherung sowie Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen und die Anpassung von Qualitätssicherungsverfahren», so Buchem.
Open Badges: Bilddateien mit Nachweisen
Opfen Badges sind vergleichbar mit digitalen Fotos, welche Metadaten enthalten: Sie informieren über Empfängerin oder Empfänger, ausstellende Institution, Vergabekriterien oder Kompetenzrahmen. Dank den Verweisen sind die Kompetenzen besser einzuordnen und zu vergleichen. «Open Badges werden aktuell in einer Vielzahl von Kontexten eingesetzt, u.a. in der beruflichen Weiterbildung und in Schulungen in Unternehmen», schreibt Buchem. Dank eines sicheren Verifikationsmodells sind Open Badges auch nicht manipulierbar. Die Besitzerinnen und Besitzer der Open Badges können selbst entscheiden, wo die mit Metadaten versehene Bilddatei, geteilt wird.
Data Wallets: Digitale Zeugnisbrieftaschen
Irgendwo müssen digitale Kompetenznachweise gespeichert, gesammelt und verwaltet werden können. Eine Möglichkeit sind die Data Wallets, wo Nachweise und Dokumente auch filter- und teilbar sind. So ist eine Online-Infrastruktur für Lehr- und Lernformate möglich. Hier sind bereits vielversprechende Lösungen vorhanden, wie beispielsweise der Standard der Europäischen Digitalen Bildungsnachweise «European Digital Credentials for Learning EDB», mit Hilfe dessen digitale Zeugnisse fälschungssicher und datenschutzkonform ausgewiesen werden können.
«Die Wertigkeit von digitalen Kompetenznachweisen wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter die Anerkennung der ausstellenden Institution oder Person, die Transparenz der Vergabeproesse, die Anwendung von Qualitätsstandards und die Relevanz für den Arbeitsmarkt», schreibt Buchem in ihrem Fazit.
Um den Mehrwert dieser neuen Instrumente zu nutzen, sei es entscheidend, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und anderen relevanten Akteuren zu stärken. Auch sollten Herausforderungen wie Bedenken zum Datenschutz oder technische Barrieren angegangen werden.
Auch der SVEB beschäftigt sich mit Micro-Credentials und ist daran, Grundlagen für eine nationale Umsetzung zu erarbeiten.