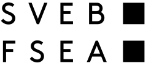Die FOCUS-Studie des SVEB zeigt, dass die meisten Weiterbildungsanbieter in der Schweiz sich zwar viel von KI erhoffen, aber noch nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen, um KI einzusetzen. Bildungsberater und KI-Experte Harald Graschi nimmt diesbezüglich die Organisationen in die Pflicht.
Wie sich in der Anbieterumfrage 2024 des SVEB gezeigt hat, haben viele Anbieter KI im Frühling 2024 noch nicht eingesetzt. Das Haupthindernis sind die mangelnden Kompetenzen und die Wissenslücken in den Organisationen, obwohl die Bereitschaft vonseiten des Personals grundsätzlich gross ist. Wie schätzen Sie diese Ergebnisse ein?
Wir stehen vor einer bedeutsamen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die in den letzten zwei Jahren viele Organisationen überrollt hat. Es ist ermutigend zu sehen, dass in 80 Prozent der Weiterbildungsinstitutionen die Belegschaft grundsätzlich bereit ist, künstliche Intelligenz zu nutzen. Viele Menschen haben schon mit ChatGPT experimentiert. Um jedoch als Neuling eine Kompetenz oder gar Expertise zu entwickeln, sind viele Stunden intensiver Auseinandersetzung notwendig. Dies kann oder möchte die Einzelperson häufig nicht leisten. Es wäre die Aufgabe der Organisationen, eine Strategie zu entwickeln, ob und wie sie KI-Tools in ihre Prozesse integrieren und ihre Mitarbeitenden entsprechend schulen. Für eine funktionierende KI-Strategie benötigen die Organisationen jedoch Ressourcen, Expertise und Personal, um mögliche Entwicklungsfelder und didaktische Szenarien zu erproben, Best-Practice-Erfahrungen auszutauschen und zu reflektieren. Diese Projekte sind in Weiterbildungseinrichtungen mit vielen nebenberuflich angestellten Ausbildenden und einer schlanken Verwaltungsstruktur weder personell noch finanziell in kurzer Zeit zu bewältigen. Zudem müsste der Aufwand durch eine dringende Marktnotwendigkeit oder einen hohen Synergieeffekt gerechtfertigt sein. Gerade im Weiterbildungssektor der kleinräumig strukturierten Schweiz ist dies selten der Fall. Daher sollten über die Landes- und Sprachgrenzen der Schweiz hinweg Konzepte z.B. für die Individualisierung von Lernprozessen und den Einsatz von digitalen Assistenten entwickelt werden, um die Bildungsteilhabe für alle zu ermöglichen. Gerade Hochschulen mit ICT-Weiterbildungsabteilungen und international tätige Firmen mit einer Learning & Development-Strategie verfügen über diese Voraussetzungen.
Bisher haben nur wenige Anbieter interne KI-Richtlinien entwickelt. Die meisten lassen ihre Mitarbeitenden frei über den Einsatz von KI entscheiden. Was sollten Organisationen beachten, wenn sie KI sicher einsetzen wollen?
Ein Blick in die «eLearning Benchmarking Studie 2024» zu KI in der betrieblichen Bildung zeigt, dass knapp 70 Prozent der Unternehmen sich in der Erkundungs- und Experimentierphase befinden. Die Ergebnisse der Anbieterumfrage des SVEB zeichnen ein ähnliches Bild. Jede Woche überschwemmt eine Unzahl von Angeboten den Markt mit mehr oder weniger ausgereiften Produkten. Hier beobachte ich, und die Umfrage bestätigt es, dass es häufig den Ausbilderinnen und Ausbildern überlassen wird, was sie einsetzen. Es ist aus meiner Sicht wünschenswert, dass die Leitung stärker Einfluss darauf nimmt, klare Eckwerte setzt und Zugänge schafft. Das bedeutet jedoch auch, dass diese Kosten von der Organisation getragen werden sollten. Ein wichtiges Thema ist die Datensicherheit. Sobald es um die Themen Lernunterstützung und Leistungsnachweise geht, muss klar unterschieden werden, mit welchen Inhalten die KI-Plattformen gefüttert werden. Was passiert mit den Daten, wo werden sie gespeichert und wozu werden sie weiterverwendet? Hier sehe ich eine grosse Grauzone, die immer noch nicht geklärt ist. Es ist naiv zu glauben, dass die Tech-Giganten diese Dienste weiterhin kostenlos und ohne Monetarisierungsmodell zur Verfügung stellen werden. Gerade dann, wenn nichts gezahlt wird, sind die Nutzerdaten und Inhalte die wirkliche Währung. Bei reinen Fertigkeits- und Wissensübungen ist dies weniger problematisch als bei kompetenzorientierten Aufgaben, die die eigene Situation oder Praxis widerspiegeln.
Zwei Drittel der Anbieter gehen davon aus, dass KI zu einer starken Veränderung der Kompetenzanforderungen in den Organisationen führt. Wie verändern sich gemäss Ihrer Einschätzung die Kompetenzen des (Weiter-)Bildungspersonals?
2025 tritt die AI-Verordnung der EU in Kraft und verpflichtet die Unternehmen, dass ihr Personal über ein ausreichendes Mass an KI-Kompetenzen (AI Literacy) verfügt. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, «KI-Systeme sachkundig einzusetzen sowie sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden, die sie verursachen kann, bewusst zu werden» (Kap. I, Art. 3, Abs. 56). Das ist auch für uns in der Schweiz relevant. Für das Kompetenzprofil des Bildungspersonals zeigen die Ergebnisse der Anbieterumfrage des SVEB zwei relevante Felder auf: die Erstellung von Lernmaterialien und die Planung und Gestaltung von Angeboten. Mit guten Prompts können gerade Einsteigerinnen und Einsteiger schnell erste Resultate erzielen, die für die Weiterverarbeitung geeignet sind. Auch die Anpassung von Texten auf zielgruppenspezifische Sprachniveaus oder die Übersetzung von Text und Audio in andere Sprachen funktioniert bereits hervorragend und wird genutzt. Diese ersten Anwendungsfelder mit bekannten Tools können mit überschaubarem Aufwand an nebenberuflich ausbildende Fachpersonen weitergegeben werden. Unabhängig von diesen digitalen Hilfestellungen sollten zentrale menschliche Eigenschaften weiterhin im Mittelpunkt stehen: die Empathie für die Zielgruppe, die ständige kreative Weiterentwicklung der Lehr- und Lernprozesse und eine kritische Denkhaltung. Auf der operativen und strategischen Ebene einer Organisation gilt es zu unterscheiden und zu entscheiden, wann und wie eine glaubwürdige KI-Anwendung eingesetzt werden soll. Dieser Personenkreis klärt nicht nur die Frage «Wie benutze ich das?», sondern versteht auch die technologische Perspektive «Wie funktioniert das?» und die gesellschaftlich-kulturell relevante Frage «Wie wirkt das?». Von Francis Bacon stammt der Satz: «Wissen ist Macht». Wir sollten gut darauf achten, dass nicht alle Daten bei wenigen privatwirtschaftlich orientierten Tech-Giganten landen und damit ein Informationsmonopol entsteht.
Aus meiner Sicht stehen folgende Themen auf der Prioritätenliste, wenn KI-Systeme eingesetzt werden:
– Ausrichtung und Ethik: Organisationen sollten sicherstellen, dass KI-Anwendungen fair, transparent und im Einklang mit den Unternehmenswerten eingesetzt werden. Computer und KI- Systeme verrichten ihre Arbeit unermüdlich und hocheffizient gemäss dem Auftrag und Parametern, die ihnen mitgegeben werden. Wonach sie sich ausrichten sollen, wird von Menschen vorgegeben. Eine nicht vollständig durchdachte Zielvorgabe kann katastrophale Folgen haben, wenn sie nicht mehr nach- vollziehbar von Maschinen automatisiert ausgeführt werden (Alignment-Problem).
– Kritische Überwachung der Ergebnisse. Gerade wenn Zeit gespart wird, um automatische Ergebnisse zu erhalten oder gar Entscheidungen zu treffen, braucht es Menschen, welche diese Ergebnisse überwachen und auf ihre Konsistenz hin bewerten. – Risikomanagement des KI-Einsatzes. Die Einbindung von KI- Expertengruppen und Datenschutzbeauftragten kann helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und Massnahmen festzulegen.
– Datenqualität und Datenschutz. Nebst der strikten Einhaltung der Datenschutzbestimmungen muss das gesamte Personal zu diesem Thema sensibilisiert und geschult werden. Auf der Ebene der einzelnen Kursleitung liesse sich diese Liste sicherlich weiterführen. Die konkreten Kompetenzen hängen jedoch sehr von der Ausrichtung und den Entscheidungen der jeweiligen Organisation ab.
Harald Graschi ist Bildungsberater und Medienpädagoge mit langjähriger Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung von Berufs- und Erwachsenenbildnern. Seit der Gründung eines Internet-Cafés mit einer Schülergruppe 1993 ist er an technologischen Innovationen und deren mediendidaktischen Umsetzung interessiert und konzeptionell involviert.