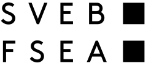Die künstliche Intelligenz spielt den «schwierigen» Kunden: Ein preisgekröntes Projekt hat KI als Ansprechpartner eingesetzt, um Kundengespräche zu simulieren. Projektleiter Martin Berger stellt klar, dass es beim Einsatz von KI nicht um das Automatisieren von Lernen, sondern um das Ermöglichen von Lernen gehen soll.
Herr Berger, Sie haben für ein Projekt KI und VR eingesetzt, um heikle Situationen der Kommunikation zu simulieren. Was ist Ihr Fazit?
In unserem Projekt haben wir ein digitales Trainingssystem entwickelt, mit dem Lernende im Detailhandel schwierige Kundengespräche üben können, über den Handyscreen oder immersiv mit der VR-Brille. Statt mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern sprechen sie mit einem KI-gesteuerten Kunden-Avatar und reflektieren danach ihr Kommunikationsverhalten mit einem virtuellen Coach. Die ersten Rückmeldungen aus einer kleinen Feldstudie sind sehr positiv: Die Lernenden empfanden die Gespräche als realistisch und hilfreich, besonders zur Vorbereitung auf Prüfungssituationen. Sie konnten in einem sicheren Rahmen üben, Fehler machen und direkt daraus lernen. Mich beeindruckte, wie stark die Applikation Lernende ins Handeln gebracht hat. Als Lehrer und Dozent habe ich mittlerweile viel Unterricht gesehen, jedoch mag ich mich nicht daran erinnern, einmal eine so hohe verbale Beteiligung erlebt zu haben.
Auf welche Schwierigkeiten und Fragen sind Sie gestossen?
Die grösste Herausforderung lag nicht in der Technik, sondern im «Feintuning» der pädagogischen Wirkung. Der virtuelle Kunde reagierte manchmal noch zu vorhersehbar. Emotionen, spontane Reaktionen oder Missverständnisse, wie sie in echten Gesprächen vorkommen, fehlen teilweise noch. Auch das Feedback der KI war zwar gut strukturiert, aber inhaltlich oft zu allgemein. Diese Erfahrungen zeigen: Wenn KI im Lernen sinnvoll eingesetzt werden soll, braucht sie ein gutes pädagogisches Design. Und sie wirft neue Fragen auf. Etwa, wie man automatisiertes Feedback mit menschlicher Begleitung kombiniert, damit Lernen persönlich bleibt, auch wenn das Gegenüber virtuell ist.
Ist KI «nur» für solche Rollenspiele geeignet. Oder was ist sonst noch denkbar?
Nein, ganz und gar nicht. Rollenspiele sind zwar ein naheliegender Einstieg, weil KI dort ihre dialogische Stärke zeigt, denn sie kann in Echtzeit reagieren und unterschiedliche Rollen übernehmen. Aber das Potenzial reicht weit darüber hinaus. Wir sehen grosse Chancen überall dort, wo Lernen durch Rückmeldung, Individualisierung oder Simulation unterstützt werden kann, also etwa beim Coaching, in der Diagnostik von Lernprozessen oder beim Training von Entscheidungs- und Problemlösekompetenzen. KI kann Lernende gezielt fordern, ohne sie zu überfordern, und Lehrpersonen entlasten, indem sie Routineaufgaben übernimmt und mehr Raum für individuelle Begleitung schafft.
Wo sehen Sie das grösste Potenzial für den Einsatz von KI in der Erwachsenenbildung generell?
In der Erwachsenenbildung geht es oft um sehr heterogene Gruppen und begrenzte Lernzeit. Hier kann KI helfen, Lernprozesse stärker zu flexibilisieren und personalisieren. Beispielsweise kann KI neue Formen der Selbststeuerung und Reflexion fördern, etwa indem sie als Sparringspartner dient, der Fragen stellt und Denken anregt. Der eigentliche Mehrwert liegt also nicht im Automatisieren von Lernen, sondern im Ermöglichen von Lernen, das individueller, situativer und dialogischer wird.
In einer SVEB-Umfrage unter Anbietern, kam KI vor allem bei der Erstellung von Lernmaterialien zum Einsatz. Haben Sie da auch schon Erfahrung damit? Falls ja, welche?
Ja, das ist tatsächlich ein grosser Trend und auch ich nutze generative KI eigentlich permanent. Etwa um Fallbeispiele, Quizfragen oder Rollenskripte automatisch zu variieren. Solche Anwendungen können die Vorbereitung enorm erleichtern. Gleichzeitig braucht es klare Qualitätskontrollen: Gute (Lern-)Materialien entstehen nicht durch Knopfdruck, sondern durch das Zusammenspiel von Fachdidaktik und KI-Werkzeug. Ich sehe KI hier als Co-Autorin, die hilfreich, aber nicht eigenständig ist.
KI steckt noch in den Kinderschuhen, könnte man sagen: Liegt da noch enorm viel Potenzial brach oder ist der Hype viel zu gross und folgt nun Ernüchterung?
Beides stimmt ein Stück weit. Der Hype ist gross und vieles, was versprochen wird, ist heute technisch oder didaktisch noch nicht ausgereift, oder wird wohl kaum jemals in der versprochenen Form zutreffen. Gleichzeitig erleben wir in unseren Projekten, dass KI-gestützte Anwendungen einen echten Mehrwert schaffen können, wenn sie klug eingebettet sind. Wir stehen also nicht am Ende, sondern am Anfang einer Lernkurve. Die Technologie entwickelt sich rasant, und mit jeder Iteration wird sie glaubwürdiger, flexibler und besser steuerbar. Entscheidend wird sein, ob wir sie pädagogisch sinnvoll nutzen.
Inwiefern wird sich die Rolle der Ausbildenden und Kursleitenden verändern?
Die Rolle der Ausbildenden und Kursleitenden wird sich eher erweitern als verringern. KI kann Routinearbeit übernehmen, aber das, was wirklich zählt, bleibt menschlich: Beziehung, Motivation, Beurteilung, Orientierung. Ausbildenden werden künftig stärker zu Lernbegleiterinnen und -begleitern, die KI-gestützte Werkzeuge gezielt einsetzen, Ergebnisse kritisch einordnen und Lernprozesse moderieren. Das erfordert neue Kompetenzen, aber auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Technologie. Ich sehe darin weniger eine Bedrohung als eine Chance, die eigene Professionalität neu zu definieren, mit mehr Zeit für das Wesentliche: das Lernen der Menschen.
Martin Berger ist Dozent in der Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung an der PH Zürich.
Das Projekt Embodied Conversational Agents wurde diesen Herbst im Rahmen der internationalen AI in Education Competition 2025 in Hong Kong mit dem Outstanding Innovation and Creativity Award ausgezeichnet.