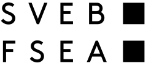Basierend auf den PIAAC-Daten hat die OECD eine Studie zur Teilnahme an Weiterbildungen veröffentlicht. Fazit: Die Teilnahme entspricht nicht den heutigen Qualifikationsanforderungen, die Angebote sind kurzfristig ausgerichtet und sie erreichen nicht jene, die sie am meisten nötig hätten.
Der am 8. Juli veröffentlichte Bericht «Trends in Adult Learning: New Data from the 2023 Survey of Adult Skills» bewertet den Stand der Erwachsenenbildung in den OECD-Ländern und untersucht Trends bei den Teilnahmequoten und den Angebotsformen der Erwachsenenbildung, wobei er sich auf die PIAAC-Daten stützt.
Folgendes hält der Bericht fest:
Die Beteiligung an der Erwachsenenbildung stagniert
Die Beteiligung an der Erwachsenenbildung ist trotz gemeinsamer Bestrebungen, den Zugang zu erweitern und gemeinsame Ziele zu erreichen, von Land zu Land sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt nehmen etwa 40 Prozent der Erwachsenen in den OECD-Ländern jedes Jahr an Bildungsmassnahmen teil, wobei die nationalen Zahlen zwischen 58 Prozent in Finnland und Norwegen und 13 Prozent in Korea liegen. Englischsprachige und nordische Länder weisen tendenziell die höchsten Beteiligungsquoten auf. In vielen Ländern scheint die Beteiligung jedoch zurückzugehen, was angesichts der entscheidenden Rolle der Erwachsenenbildung für die Anpassung an den wirtschaftlichen und technologischen Wandel ein besorgniserregender Trend ist. Nur in Irland und Estland ist die Beteiligung an der Erwachsenenbildung deutlich gestiegen – um rund 5 Prozentpunkte –, was auf die zunehmende Teilnahme an nicht formaler berufsbezogener Bildung zurückzuführen ist. In Ländern wie Korea und Israel ist hingegen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Zwar bestehen weiterhin Unterschiede in der Teilnahme zwischen sozioökonomischen Gruppen, doch einige davon verringern sich – nicht weil benachteiligte Gruppen stärker teilnehmen, sondern weil der Rückgang bei denjenigen am stärksten ist, die früher an der Spitze der Teilnahme standen: Männer, Besserverdienende und hochqualifizierte Arbeitnehmer in qualifizierten Berufen. So hat sich beispielsweise die geschlechtsspezifische Kluft aufgrund eines stärkeren Rückgangs bei Männern als bei Frauen praktisch geschlossen. Diese Verschiebungen unterstreichen einen besorgniserregenden Trend: Selbst wenn sich die Unterschiede verringern, geht die Gesamtbeteiligung zurück. Dies verstärkt die Notwendigkeit gezielter Massnahmen, um strukturelle Hindernisse zu beseitigen und den Zugang für diejenigen zu verbessern, die am meisten davon profitieren würden. In Ländern, in denen die Beteiligung an der Erwachsenenbildung zurückgeht, ist auch die durchschnittliche Alphabetisierungsrate eher gesunken. Zwar lässt sich kein kausaler Zusammenhang feststellen, doch weist diese Beziehung auf ein allgemeineres Problem hin: Der eingeschränkte Zugang zu Bildungsangeboten kann die Fähigkeit von Erwachsenen beeinträchtigen, ihre Informationsverarbeitungsfähigkeiten aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, während gleichzeitig geringe Informationsverarbeitungsfähigkeiten ein Hindernis für weiteres Lernen darstellen können. Zusammengenommen könnten diese Trends auf einen sich gegenseitig verstärkenden Kreislauf hindeuten, der mit der Zeit zu einem Qualifikationsverlust führen könnte.
Kurzfristige und auf Compliance ausgerichtete Schulungen dominieren
Die formale Bildung spielt in der Erwachsenenbildung eine immer geringere Rolle. Im Durchschnitt der OECD-Länder nehmen nur 8 Prozent der Erwachsenen an formalen Bildungsprogrammen teil, und die Beteiligung ist zwischen den Erhebungszeiträumen um mehr als zwei Prozentpunkte zurückgegangen. Im Gegensatz dazu ist nicht formales berufsbezogenes Lernen mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 37 Prozent der Erwachsenen nach wie vor weiter verbreitet. Zwar ist auch das nicht formale Lernen leicht zurückgegangen – um rund 3 Prozentpunkte –, doch ist dieser Trend nicht überall zu beobachten. Fünf Länder oder Volkswirtschaften (England [Vereinigtes Königreich], Estland, die flämische Region Belgiens, Irland und Italien) verzeichnen einen statistisch signifikanten Anstieg des nicht formalen berufsbezogenen Lernens. Bemerkenswert ist, dass Länder, die in einer Form des Lernens gute Ergebnisse erzielen, in der Regel auch in der anderen Form gut abschneiden, was darauf hindeutet, dass beide Formen durch robuste, gut entwickelte Erwachsenenbildungssysteme unterstützt werden. So weisen beispielsweise Finnland, Norwegen und die Vereinigten Staaten – Länder, in denen mehr als die Hälfte der Erwachsenen in den zwölf Monaten vor der Erhebung an nicht formalem berufsbezogenem Lernen teilgenommen hat – auch überdurchschnittliche Beteiligungsquoten an formaler Erwachsenenbildung auf. Unter den Erwachsenen in formaler Bildung dominieren tertiäre Qualifikationen. Im Durchschnitt findet 65 Prozent der formalen Erwachsenenbildung auf tertiärer Ebene statt, wobei die Spanne von 90 Prozent in Italien und der Tschechischen Republik (Tschechien) bis zu weniger als 40 Prozent in Kanada reicht. In einigen Ländern ist der Grossteil der formalen Erwachsenenbildung auf postsekundäre Abschlüsse ausgerichtet (z. B. Kanada, Vereinigte Staaten), während es sich in anderen Ländern hauptsächlich um Bildungsangebote für Erwachsene handelt (z. B. England, Frankreich – Spanien). Gesundheits- und Sicherheitsschulungen sind die häufigste Form der nicht formalen berufsbezogenen Bildung (18 Prozent aller Bildungsmassnahmen in dieser Kategorie). Obwohl sie unverzichtbar ist, lässt ihre Dominanz – insbesondere in Ländern, in denen sie ein Viertel oder mehr des gesamten Lernens ausmacht (Finnland, Irland, Italien, Norwegen, Slowakische Republik) – darauf schliessen, dass ein noch geringerer Anteil der Ausbildung der Umschulung und Weiterqualifizierung gewidmet ist, um den sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Ein grosser Teil des nicht formalen berufsbezogenen Lernens besteht aus sehr kurzen Aktivitäten. Etwa 42 Prozent der nicht formalen berufsbezogenen Lernaktivitäten dauern einen Tag oder weniger, weitere 40 Prozent zwischen einem Tag und einer Woche. Kurze Formate fördern zwar die Teilnahme, eine übermässige Abhängigkeit davon kann jedoch das Potenzial für eine tiefgreifendere oder transformativere Umschulung einschränken. Modulare Lernpfade und stapelbare Qualifikationen können dazu beitragen, dass kurze Kurse im Laufe der Zeit zu einem bedeutenden Kompetenzgewinn führen. Arbeitslose Erwachsene nehmen tendenziell an längeren Schulungen teil. Während nur 15 Prozent der erwerbstätigen Erwachsenen an nicht formalen berufsbezogenen Lernaktivitäten teilnahmen, die länger als eine Woche dauerten, waren es bei den arbeitslosen Erwachsenen 38 Prozent. Arbeitslose Erwachsene haben weniger zeitliche Einschränkungen, da sie keine beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Ausbildungsbedürfnisse von erwerbstätigen und arbeitslosen Erwachsenen oft voneinander. Erwerbstätige Erwachsene benötigen in der Regel kurze, gezielte Lernaktivitäten, um spezifische Kompetenzen zu erwerben, die ihre aktuellen beruflichen Aufgaben ergänzen. Arbeitslose Erwachsene benötigen hingegen möglicherweise umfassendere Schulungen, um ein breiteres Spektrum an Kompetenzen zu entwickeln, die sie auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger machen und ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern.
Hindernisse für die Erwachsenenbildung sind nach wie vor weit verbreitet und ungleich verteilt
Die Verbesserung der beruflichen Leistung und Beschäftigungsfähigkeit ist nach wie vor die Hauptmotivation für erwachsene Lernende. Diese Motivation ist in den letzten zehn Jahren unverändert geblieben. Die meisten Erwachsenen halten Weiterbildungen für nützlich. Fast die Hälfte aller Lernenden bewertet ihre Weiterbildung als sehr nützlich, und mehr als drei Viertel finden sie zumindest mässig nützlich. In Ländern, in denen Weiterbildungen als nützlicher empfunden werden, ist die Teilnahme tendenziell höher. Allerdings hat im Durchschnitt die Hälfte aller Erwachsenen in den OECD-Ländern in den zwölf Monaten vor der Erhebung weder an Erwachsenenbildung teilgenommen noch daran teilnehmen wollen. Für diejenigen, die teilnehmen wollten, bestehen nach wie vor weit verbreitete Hindernisse. Jeder vierte Erwachsene stiess in den zwölf Monaten vor der Erhebung auf Hindernisse bei der Teilnahme an Erwachsenenbildung. Die am häufigsten genannten Gründe sind Zeitmangel – aufgrund beruflicher oder familiärer Verpflichtungen – und Kosten. Diese Herausforderungen sind für einige Gruppen besonders gravierend. Frauen, jüngere Menschen und Personen mit höherem Bildungsniveau geben am häufigsten Hindernisse an. Arbeitgeber spielen eine entscheidende Rolle. Der Grossteil der Weiterbildung findet am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit statt; die Unterstützung durch den Arbeitgeber ist einer der wichtigsten Faktoren für die Teilnahme. Der Anteil der Erwachsenenbildung, der während der Arbeitszeit stattfindet, ist seit dem ersten PIAAC-Zyklus in den meisten Ländern gestiegen, wenn auch nur in einigen Ländern signifikant. Partnerschaften zwischen Regierungen und Unternehmensführern können dazu beitragen, den Zugang zu hochwertigen, relevanten Bildungsangeboten zu verbessern. Weiterbildungen unterstützen auch die Anpassung der Arbeitskräfte. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen, deren Arbeitsplatz sich in den letzten drei Jahren verändert hat, geben an, dass sie Weiterbildungen erhalten haben, um sich anzupassen. Unterstützung ist besonders häufig an Arbeitsplätzen zu finden, die einen technologischen Wandel durchlaufen, beispielsweise durch die Einführung neuer digitaler Systeme.
Ein Paradigmenwechsel in der Erwachsenenbildungspolitik ist erforderlich
Die Erwachsenenbildungssysteme stehen unter Druck. Trotz der weit verbreiteten Anerkennung der Notwendigkeit einer lebenslangen Kompetenzentwicklung ist die Teilnahme nach wie vor gering und ungleichmässig verteilt. Kosten- und Zeitbarrieren schliessen weiterhin die Bedürftigsten aus, und die öffentlichen Investitionen sind nach wie vor stark auf die Erstausbildung ausgerichtet. Allzu oft ist die Weiterbildung reaktiv und konzentriert sich auf die Einhaltung grundlegender Vorschriften, anstatt den Arbeitnehmern übertragbare Kompetenzen für zukünftige Aufgaben zu vermitteln. Um den Anforderungen des sich schnell wandelnden Arbeitsmarktes gerecht zu werden, muss die Politik von fragmentierten, kurzfristigen Lösungen zu umfassenden Strategien übergehen, die Finanzierung, Arbeitgeberengagement und flexible Bereitstellungsmodelle integrieren. Nur eine mutige, systemische Reformagenda kann sicherstellen, dass alle Erwachsenen sinnvolle Möglichkeiten haben, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für ein erfolgreiches Leben benötigen.
Erwachsenenbildung hinkt hinterher
Im Policy brief führt die OECD noch aus und formuliert konkrete Forderungen:
- Die Erwachsenenbildung hinkt hinter den sich rasch wandelnden Qualifikationsanforderungen hinterher. In einer Welt, die durch Digitalisierung, Alterung der Bevölkerung und den ökologischen Wandel geprägt ist, hält die Erwachsenenbildung nicht Schritt. Dies ist nicht nur eine verpasste Chance für den Einzelnen, sondern gefährdet auch ganze Volkswirtschaften, die Gefahr laufen, im Wettlauf um Talente und Wirtschaftswachstum ins Hintertreffen zu geraten.
- Diejenigen, die am meisten benötigen, bilden sich am wenigsten weiter. Erwachsene mit geringerem Bildungs- und Einkommensniveau sowie in gering qualifizierten Berufen nehmen durchweg seltener an Bildungsmassnahmen teil. Zwar haben sich einige Lücken verringert, dies ist jedoch grösstenteils auf einen Rückgang der Beteiligung von Gruppen mit traditionell höheren Beteiligungsquoten, wie Männern, Hochgebildeten und Besserverdienenden, zurückzuführen und nicht auf eine stärkere Beteiligung benachteiligter Erwachsener. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, alle Menschen, insbesondere diejenigen, die am weitesten vom Lernen entfernt sind, zu befähigen, sich um ihre Kompetenzentwicklung zu kümmern.
- Der Grossteil der Erwachsenenbildung bleibt hinter dem Bedarf zurück: 42 Prozent der nicht formalen Aktivitäten dauern im Durchschnitt nur einen Tag oder weniger. Kurze Formate können den Zugang verbessern – insbesondere für Erwachsene, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen –, aber sie sind nicht immer geeignet, um eine tiefgreifende Umschulung zu unterstützen. Sie können dennoch wirksam sein, um gezielt Fähigkeiten zu verbessern, beispielsweise beim Erlernen eines neuen digitalen Tools oder beim Kennenlernen eines umweltfreundlichen Materials. Viele Angebote konzentrieren sich jedoch auf Compliance-Themen wie Gesundheit und Sicherheit anstatt auf zukunftsorientierte Kompetenzen, die für den ökologischen und digitalen Wandel erforderlich sind. Ohne eine bessere Integration modularer Lernangebote in Qualifikationen und klarere Verbindungen zu neu entstehenden Qualifikationsanforderungen könnte die Erwachsenenbildung den langfristigen Wandel der Arbeitswelt nicht ausreichend unterstützen.
- Die Politik muss Erwachsene dazu ermutigen, mehr Eigenverantwortung dafür zu übernehmen, warum, was, wie, wo und wann sie in ihr Leben investieren. Dies erfordert eine grundlegende Neugestaltung der Erwachsenenbildungssysteme, die finanzielle Anreize, Zeitausgleich, flexible Bildungswege und eine solide Qualitätssicherung miteinander verbindet. Massnahmen wie individuelle Bildungskonten, Bildungsurlaub und Zuschüsse müssen ausgebaut und gezielter auf diejenigen ausgerichtet werden, die am wenigsten daran teilnehmen. Gleichzeitig sind Echtzeit-Arbeitsmarktinformationen und die Anerkennung früherer Lernerfahrungen unerlässlich, um sicherzustellen, dass Erwachsenenbildung zu besseren Karrieren und einem besseren Leben führt.