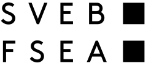Was bedeutet es, dass 30 Prozent der Wohnbevölkerung in der Schweiz Probleme mit Grundkompetenzen haben? Und was ist zu tun? Der SVEB hat die wichtigsten Fragen zu den PIAAC-Daten beantwortet und eingeordnet.
Antworten: Cäcilia Märki und Helen Buchs
Die PIAAC-Zahlen sind die wichtigsten Zahlen zu Grundkompetenzen in der Schweiz seit 2006. Warum gibt es nicht mehr Erhebungen dazu?
Die Schweiz hat an der PIAAC Erhebung von 2011 nicht teilgenommen. Die OECD erhebt die Daten für die Erwachsenen in regelmässigen Wellen, an denen Länder teilnehmen können oder nicht. Die Erhebungen sind aufgrund der Kompetenzmessungen sehr aufwendig und die Kosten entsprechend erheblich.
Was sind die grössten Erkenntnisse aus den PIAAC-Zahlen?
Die Erkenntnisse aus dem ersten Bericht des BFS sind nicht erstaunlich, aber beeindruckend: 30 Prozent der Wohnbevölkerung hat Mühe mit mindestens einer der drei gemessenen Kompetenzen. 57 Prozent der Erwachsenen mit geringen Lesekompetenzen (Stufe 1 und darunter), deren Hauptsprache der PIAAC-Testsprache entsprach, haben einen SEK II-Abschluss. Es sind somit nicht nur Personen mit tiefem Bildungsstand betroffen. Es ist bemerkenswert, dass die Disparität in der Schweiz gross und der Einfluss sozioökonomischer Faktoren, wie dem Bildungsstand der Eltern, hoch ist. Interessant ist weiter, dass die Kompetenzen bei älteren Personen tiefer sind als bei jüngeren, trotz vergleichbarem Bildungsstand. Wobei aufgrund der einmaligen Messung nicht klar ist, ob es ein Alters- oder ein Generationeneffekt ist. Internationale Zahlen deuten darauf hin, dass beide Faktoren eine Rolle spielen.
Für Detailauswertungen sind die beiden Berichte abzuwarten, deren Veröffentlichung für den Herbst 2025 geplant ist. Der erste Bericht wird untersuchen, wie der Erwerbsstatus und Merkmale der Erwerbstätigkeit mit den Kompetenzen zusammenhängen. Der zweite Bericht widmet sich den Personen mit geringen Grundkompetenzen. Er analysiert, wer sie sind, was sie machen und wie sie an der Gesellschaft und an Weiterbildung teilnehmen.
Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?
Die durchschnittlichen Kompetenzwerte der Schweiz liegen in allen Bereichen signifikant über dem OECD-Durchschnitt. Im internationalen Vergleich erreichen Finnland, Japan, Schweden, Norwegen und die Niederlande in allen drei Kompetenzbereichen die höchsten Werte. Allerdings weist die Schweiz ein besonders grosses Gefälle zwischen hochgebildeten (mit Hochschulbildung) und niedriggebildeten Erwachsenen (mit Bildung unterhalb der Sekundarstufe II) sowie solchen mit hochgebildeten und niedriggebildeten Eltern aus. Diese Unterschiede aufgrund des Bildungsstands und der sozialen Herkunft stehen im Kontrast zu den vergleichsweise hohen Durchschnittswerten.
In den letzten zehn Jahren haben sich in Bezug auf die Zahlen nur wenige Länder positiv entwickelt, die Werte der meisten Länder bleiben stabil oder nehmen sogar ab. Eine Überraschung auch für OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Dies sei weder mit Migration noch mit der alternden Bevölkerung in den OECD-Ländern zu erklären, sagte er bei der Präsentation der Daten. Stattdessen stellt er eine «wachsende soziale Disparität» und einen «Leistungsabstand» fest. Sprich: Das Gefälle zwischen den Leistungsstärksten und -schwächsten hat sich vergrössert, da insbesondere die Kompetenzwerte der leistungsschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung weiter zurückgegangen sind.
Haben sich die Grundkompetenzen in der Schweiz in den letzten 20 Jahren verbessert oder verschlechtert?
Das lässt sich aufgrund der Daten nicht beantworten, da die Zahlen der ALL-Studie 2006 und PIAAC 2023 nicht vergleichbar sind. In den meisten Ländern, die bereits früher an den PIAAC Erhebungen teilgenommen haben, ist eine Verschlechterung feststellbar. Bei den PISA-Erhebungen, dem Pendant zu PIAAC bei Schülerinnen und Schülern, ist dieser Trend auch für die Schweiz ersichtlich.
Wie sind die Ergebnisse einzuordnen?
Die Daten zeigen, dass tiefe Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Problemlösen kein vernachlässigbares Randphänomen ist, sondern einen grossen Teil der Bevölkerung betreffen. Die Förderung von Kompetenzen ist deshalb eine wichtige Aufgabe. Zudem braucht es den Fokus auf Grundkompetenzen, weil die Disparität in der Schweiz so hoch ist. Werden die Personen mit den tiefsten Kompetenzniveaus vernachlässigt, wird das in Zukunft nicht nur den gemessenen Durchschnitt negativ beeinflussen, sondern auch zum Risiko führen, dass breite Bevölkerungsschichten angesichts der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen den Anschluss verlieren. Bezüglich dem durchschnittlichen Kompetenzniveau ist die konstante Förderung der Kompetenzen bei Erwachsenen nötig, um das gute Niveau zu halten und einer Verschlechterung über die Zeit entgegenzuwirken. Denn erstens scheinen mit dem Alter die Kompetenzen eher abzunehmen und zweitens haben die internationalen Messungen gezeigt, dass von einer Verschlechterung über die Zeit auszugehen ist.
Insofern bestätigen die PIAAC-Daten, dass die Förderung der Grundkompetenzen im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (WeBiG) notwendig ist. Sie bestätigen ebenfalls, dass die Erhöhung der Mittel durch das Parlament von 42 auf 59 Millionen für die Förderperiode von 25-28 gerechtfertigt ist und die bisherigen Anstrengungen durch Bund, Kantone, IIZ und die Organisationen der Weiterbildung seit Inkrafttreten des WeBiG 2017 in die richtige Richtung gehen.
Wo besteht Handlungsbedarf?
Die PIAAC-Daten demonstrieren, dass die Schweiz verstärkt in das Erreichen der Zielgruppen und in die Angebotsentwicklung investieren sowie die Förderung der Grundkompetenzen in allen Spezialgesetzen priorisieren sollte. Auch die Koordination zwischen den Förderstrukturen und die Vernetzung sollte verbessert werden. Ferner sollten die Anstrengungen für den Einstieg in den Berufsabschluss für Erwachsene verstärkt werden, insbesondere in zukunftsträchtigen Branchen analog zur Integrationsvorlehre (Invol). Zentral sind vorgelagerte oder begleitenden Grundkompetenzkurse zur Förderung von Bildungs- und Lernwegen bis zu einem anerkannten Abschluss.
Ausserdem sind die Ansprache-Strategien für muttersprachige Personen verbesserungsfähig, insbesondere über Betriebe und Branchenverbände. Entsprechend sind regionale, niederschwellige Angebote für Grundkompetenzen in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Gemeindezentren, Vereine, Schreib- und Lernstuben, Seniorenverbände und -einrichtungen, usw.) auszubauen.
Die Grundkompetenzförderung im Kontext der Erwerbslosigkeit (Arbeitsmarktliche Massnahmen, Arbeitsintegrationsmassnahmen) lässt sich ebenfalls noch verstärken, genauso die Sensibilisierung der RAVs für die Förderung der Grundkompetenzen. Die Förderung der Grundkompetenzen ist gegenüber einer raschen Eingliederung zu priorisieren.
Auch können die Arbeitgeber und Branchenverbände noch stärker sensibilisiert werden, insbesondere für die arbeitsplatzbezogene Förderung der Grundkompetenzen z.B. im Rahmen des Förderschwerpunkts «Einfach besser ..am Arbeitsplatz!» und die branchenspezifische Sprachförderung. Die kantonale Altersbegrenzungen von 65 Jahren für die Teilnahme an von den Kantonen unterstützten Angeboten müsste aufgehoben werden.