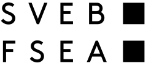Österreich, Deutschland und die Schweiz spannen bei der Professionalisierung zusammen: Beim Treffen des DACH-Netzwerks wurden Synergien ausgemacht und gemeinsame Projekte aufgegleist.
Text: Hans-Peter Karrer
Wie bereits im letzten Jahr trafen sich die Mitglieder des Netzwerks Professionalisierung aus dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung DIE, der österreichischen Weiterbildungsakademie wba und dem schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB in Zürich zu einer dreitägigen Konferenz. War der Schwerpunkt im letzten Jahr noch auf den Austausch gelegt, wollte man in diesem Jahr einen Schritt weiter gehen und den Fokus auf mögliche gemeinsame Projekte der drei Partnerinstitutionen richten. Die Grundlage dafür bot ein Kooperationsvertrag, der nach der letztjährigen Konferenz zwischen dem SVEB, dem DIE und der wba abgeschlossen wurde.
Regelungen zum Einsatz von KI
Schon beim Einstieg in die Konferenz mit dem Erarbeiten einer künftigen Strategie für das Netzwerk wurde deutlich, dass ein grosser Bedarf nach einer Zusammenarbeit bestand, gerade wenn es um Regelungen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) für die Bildungsinstitutionen in den drei Ländern geht. Alle drei Partnerinstitutionen sind bereits seit längerem daran, Richtlinien und Empfehlungen für die Arbeit mit KI zu formulieren und mit den verschiedenen Bildungsträgern zu diskutieren. Die rasante Entwicklung in diesem Bereich macht es aber nicht einfach, konkrete Regeln zum Umgang mit KI verbindlich festzulegen. Hier konnten die Konferenzteilnehmenden von der Präsentation von Vorarbeiten, Erkenntnissen und Ergebnissen aus den drei Partnerinstitutionen profitieren. Auf dem Fundament dieser breit abgestützten Überlegungen in allen drei Ländern wird es – so die Hoffnung – möglich sein, bei Bedarf eine gesicherte Position zum Umgang mit KI länderübergreifend zu formulieren.
Länderübergreifende Anerkennung von Kompetenzen
Einen grossen Raum nahm an der Konferenz die Diskussion von aktuellen Entwicklungen bei den Qualifikationen der Ausbildenden in Weiterbildungsinstitutionen ein. Dass sich die Systeme der Qualifizierung in den drei Ländern formal sehr unterschiedlich präsentieren, wurde schon bei der letzten Konferenz deutlich. Dagegen unterscheiden sich die Kompetenzen von Ausbildenden, die bei den Qualifizierungen überprüft und bestätigt werden, nur geringfügig. Auch waren sich die Konferenzteilnehmenden dahingehend weitgehend einig, dass mit der zunehmenden Digitalisierung zusätzlichen Kompetenzen bei Ausbildenden zu entwickeln und zu überprüfen sind. Es wäre sehr wünschenswert und ein grosser Schritt vorwärts, wenn die Anerkennung von Kompetenzen länderübergreifend geschehen könnte.
Gemeinsame Teilnahme an Erasmus+-Projekt
Um der Idee etwas Schub zu verleihen, hat die Konferenz darüber diskutiert, gemeinsam als DACH-Raum an einem Erasmus+-Projekt teilzunehmen. Die Ausschreibung des Projekts mit dem Titel «Vocational Education and Training: Development of joint VET qualifications and modules» entspräche ziemlich genau den Gesprächen und Ideen an der Konferenz. Die drei Partnerinstitutionen überlegen sich, den Antrag «Transnationale Anerkennung von Kompetenzen am Beispiel der Lehrkompetenzen für Erwachsenenbildnerinnen» gemeinsam zu formulieren und eine zusätzlichen Partnerinstitution aus dem Südtirol anzufragen. Konkret könnten zu einzelnen Themen der Ausbildung von Ausbildenden transnationale Microcredentials-Cluster entwickelt werden, die aus den Schnittmengen von Modellen der drei Partnerinstitutionen bestehen, aus dem GRETA-Kompetenzmodell, dem AdA-Profil und dem wba-Qualifikationsprofil.
Das dritte Thema an der Konferenz zur «Nachhaltigkeit in der Weiterbildung» konnte aus zeitlichen Gründen zwar noch positioniert, aber nicht mehr vertieft bearbeitet werden. Es soll später in den Online-Treffen des DACH-Netzwerks umfassender diskutiert werden und – bei entsprechenden Ressourcen – auch zu konkreten gemeinsamen Projekten führen.