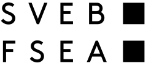Seit zwei Jahren engagieren sich Helvetas und SVEB in Mosambik: Im Rahmen des Projekts SIM! werden junge Erwachsene ausgebildet und Ausbilderinnen und Ausbilder mit dem GO-Modell unterstützt. Das sind die bisherigen Erkenntnisse.
Mosambik gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die nationale Armutsquote stieg zwischen 2014 und 2020 von 48 Prozent auf 63 Prozent, und die Jugendarbeitslosigkeit erreichte im gleichen Zeitraum 43 Prozent, wobei junge Frauen überproportional betroffen sind.
Gemäss einer von Helvetas durchgeführten Umfrage unter 545 Jugendlichen sind junge Erwachsene in Ausbildung im Durchschnitt 20 Jahre alt; 30 Prozent von ihnen haben bereits ein Kind. 77 Prozent von ihnen haben Zugang zu familieneigenem Ackerland und 78 Prozent bevorzugen eine selbstständige Tätigkeit gegenüber einer formellen Beschäftigung.
Weiter haben 78 Prozent von ihnen die Schule abgebrochen und 40 Prozent haben aufgrund wirtschaftlicher Zwänge oder der Entfernung zur Schule nur die Primarschule besucht. Generell liegt in Mosambik die Alphabetisierungsrate bei erwachsenen Frauen bei 45 Prozent und jene der Männer bei 73 Prozent.
Seit 2017 unterstützt Helvetas Projekte in Mosambik, die sich auf die Verbesserung informeller Lehrlingsausbildungen konzentrieren.
Bildungslücken schliessen
Mit dem Projekt «Skills for Youth in Mozambique» (SIM!) sollen Bildungslücken geschlossen und die Schnittstellen zwischen Grundbildung und beruflicher Bildung neu definiert werden. Durch die Einbettung von Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen in die berufliche Ausbildung vermittelt SIM! Jugendlichen und Erwachsenen die grundlegenden Fähigkeiten, die sie für ein erfolgreiches Berufsleben benötigen, und fördert so die Inklusion und eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinden.
Seit seinem Start Anfang 2023 hat das vom Bund finanzierte und von Helvetas umgesetzte Projekt rund 3600 Jugendliche ausgebildet, unterstützt von 221 lokalen Handwerkern, die als Ausbilder fungieren, und sieben Unternehmen, die sich für diese Initiative einsetzen. Das Ausbildungsmodell kombiniert vier Monate theoretischen und praktischen Unterricht mit einem zweimonatigen Praktikum, das direkte Erfahrungen am Arbeitsplatz und den Erwerb von Fähigkeiten ermöglicht. In Zusammenarbeit mit fünf Berufsbildungseinrichtungen verbessert das Projekt auch die technischen und pädagogischen Fähigkeiten der lokalen Ausbilder und gewährleistet so eine nachhaltige Kompetenzentwicklung.
Das Projekt betont, dass Lernen dort stattfinden sollte, wo es am wichtigsten ist – in realen Arbeitsumgebungen. (In der Schweiz verfolgt der Förderschwerpunkt «Einfach besser!… am Arbeitsplatz» denselben Ansatz.) In Maurerlehrgängen üben die Lernenden beispielsweise das Lesen von Bauplänen und das Berechnen von Materialien, während sie in der Agrarwirtschaftsausbildung Buchhaltungs- und Budgetierungsaufgaben bearbeiten. Dadurch wird der Nutzen der Ausbildung deutlich, was sie relevanter und wirkungsvoller macht. Module wie «Grundlagen der Geometrie für das Bauwesen», «Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz» und «Finanzkompetenz für Unternehmer» ermöglichen es den Teilnehmenden beispielsweise, neue Fähigkeiten sofort in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden.
Grundkompetenzen am Arbeitsplatz
Hierbei hilft das vom SVEB entwickelte GO-Modell: Es integriert die Vermittlung von Grundkompetenzen in den Arbeitsplatz, sodass die Beschäftigten ihre Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen sowie ihre digitalen Kompetenzen bei der Ausübung ihrer täglichen Aufgaben stärken können. Dieser arbeitsplatzorientierte und anpassungsfähige Ansatz entspricht direkt den Bedürfnissen der Unternehmen und eignet sich für Firmen jeder Grösse. In Mosambik trägt er dazu bei, kritische Lücken in der funktionalen Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz zu schliessen, die sich auf die Produktivität und Sicherheit auswirken.
Das Modell bietet ausserdem flexible Lernwege, die auf unterschiedliche Bildungshintergründe zugeschnitten sind, wobei die Schulungen häufig in gemeindenahen Einrichtungen in der Nähe des Wohnortes der Teilnehmer stattfinden. Gemischte Methoden und digitale Tools verbessern die Zugänglichkeit, insbesondere in abgelegenen Gebieten.
Ein wesentliches Merkmal des Modells sind Investitionen des Privatsektors in die Entwicklung der Arbeitskräfte, wobei Unternehmen das Lernen am Arbeitsplatz unterstützen und von einer verbesserten Mitarbeiterbindung, Effizienz und Aufgabenausführung profitieren.
Erkenntnisse aus zwei Jahren
Zwei Jahre nach dem Start des Projekts konnten anhand von Teilnehmerbewertungen, Umfragen und Rückmeldungen von Unternehmen die Schulungen auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten werden.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Stärkung der pädagogischen und technischen Kompetenzen der Handwerksausbilder. Da lokale Handwerker eine wichtige Rolle als Ausbilder am Arbeitsplatz spielen, sind Investitionen in ihre pädagogische und technische Ausbildung unerlässlich. Über die Verbesserung ihrer eigenen technischen Fähigkeiten hinaus müssen sie effektive Lehrmethoden entwickeln, um unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Hintergründen gerecht zu werden. Workshops zum Kapazitätsaufbau, Peer-Learning-Austausch und die Zusammenarbeit mit Berufsbildungseinrichtungen verbessern ihre Fähigkeit, Auszubildende effektiv zu schulen. Die Einbeziehung von Handwerkern und lokalen Verbänden in die Entwicklung der Inhalte stellt sicher, dass die Schulungsmaterialien die lokalen wirtschaftlichen und beruflichen Gegebenheiten widerspiegeln und das Gelernte direkt anwendbar ist.
- Sicherstellung einer Infrastruktur und von Materialien, die ein effektives Lernen unterstützen. Alphabetisierungs- und Rechenkurse, die in den Arbeitsalltag integriert sind, erfordern einen lernfördernden Raum mit minimalen Störungen und Zugang zu langlebigen Schulungsmaterialien. Lärm von Maschinen oder fehlende geeignete Lernbereiche können die Konzentration und das Engagement beeinträchtigen. Um die Zugänglichkeit zu verbessern, werden insbesondere in mehrsprachigen Umgebungen Illustrationen, Diagramme und visuelle Hilfsmittel eingesetzt. Die Schulungsmaterialien sollten ausserdem tragbar, langlebig und leicht anpassbar sein, damit sie an verschiedenen Arbeitsplätzen verwendet werden können.
- Gemeinschaftsorientierte Modelle verbessern die Reichweite und Nachhaltigkeit. Durch die Einbindung lokaler Animatoren, Handwerker und Gemeinschaftsorganisationen wird sichergestellt, dass die Schulungen zugänglich, vertrauenswürdig und an die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung angepasst sind. Animatoren, die oft ehrenamtlich tätig sind, spielen eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung der Teilnehmer und der Förderung der Gruppendynamik, wodurch das Modell auch in ressourcenarmen Umgebungen nachhaltig ist. Ihre engen Verbindungen zur Gemeinschaft gewährleisten, dass auch benachteiligte Gruppen, darunter Binnenvertriebene, Zugang zu Bildungsmöglichkeiten haben.
- Integrierte Schulungen verbessern die wirtschaftlichen Ergebnisse und die Produktivität. Die Verankerung grundlegender Kompetenzen in der beruflichen Bildung hat konkrete finanzielle Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Laut PIAAC können Arbeitnehmer mit besseren Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen bis zu 20 Prozent mehr verdienen. Daten aus dem Projekt zeigen, dass 40 Prozent der Auszubildenden – vor allem diejenigen mit einem Bildungsniveau der 10. Klasse oder darunter – nach Abschluss ihrer Ausbildung ein um 15 Prozent höheres Einkommen erzielten. Für Unternehmen bedeutet die Weiterqualifizierung ihrer Belegschaft höhere Effizienz, weniger Betriebsfehler und eine stärkere Mitarbeiterbindung.
- Die Stärkung grundlegender Kompetenzen bringt allen Beteiligten dauerhafte Vorteile. Das Programm geht über Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen hinaus und vermittelt den Arbeitnehmern wichtige Querschnittskompetenzen, darunter Gesundheit und Sicherheit, digitale Kompetenz, Finanzmanagement und Unternehmertum. Diese Kompetenzen werden von Arbeitgebern zunehmend gefordert und verbessern die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer in dynamischen Arbeitsmärkten. Die Stärkung dieser Bereiche kommt nicht nur den einzelnen Arbeitnehmern zugute, sondern trägt auch zur Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen bei.
- Eine inklusive Gestaltung der Schulungen ist für unterschiedliche Lernprofile unerlässlich. Viele Lernende sind mit wirtschaftlichen Zwängen, geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und familiären Verpflichtungen konfrontiert, denen das formale Bildungssystem oft nicht gerecht wird. Um diese Hindernisse zu beseitigen, finden die Schulungen in gemeindenahen Einrichtungen in der Nähe des Wohnorts der Teilnehmenden statt, wobei lokale Moderatoren die Inhalte auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse zuschneiden. Die Schulungen müssen verschiedene Lernansätze integrieren, darunter vereinfachte Sprache, visuelle Hilfsmittel und interaktive Lehrmethoden, um sicherzustellen, dass Lernende mit unterschiedlichen Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen effektiv teilnehmen können.