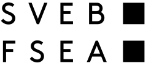Prof. Dr. Carmen Zahn lehrt und forscht zu den neuen digitalen Medien in Arbeit und Bildung. Nach der Qualitätstagung Ende Oktober konnten wir das Thema «Lernen und soziale Interaktion – Kommunikation online und onsite» mit ihr weiter vertiefen. Erfahren Sie, was diese ausgewiesene Expertin Weiterbildungsanbietern und Dozierenden empfiehlt.
Frau Prof. Zahn, in Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit Kommunikation und sozialer Interaktion in Arbeits- und Lernkontexten. Wie wichtig ist dabei die Digitalisierung?
Die Digitalisierung bzw. die digitalen Medien und Werkzeuge spielen für Arbeits- und Lernkontexte eine sehr wichtige Rolle. In Bezug auf das Lernen wird die Funktion neuer Medien bereits seit den 1990er Jahren erforscht. Dabei geht es stets um die Möglichkeiten und Grenzen spezieller digitaler Funktionen. Zum Beispiel ermöglichen interaktive Videos die Visualisierung von Dingen oder Prozessen, die wir nur sehr schwer mit blossem Auge wahrnehmen könnten, wie etwa Zellen in der Biologie oder komplexe Wetterphänomene in der Geografie.
Und wie findet dann dabei zwischenmenschlicher Austausch statt?
Die Möglichkeit, dass Lernende sozial interagieren, während sie mit Videos lernen, ist sehr eingeschränkt, wenn man sie nicht extra digital unterstützt. Wenn man also möchte, dass Lernende sozial interagieren – das heisst: mit Videos lernen, so sollte man dies in der Aufgabe berücksichtigen und spezielle Tools zusätzlich verwenden. Im Präsenzunterricht etwa dadurch, dass man Videos in Kleingruppen betrachten, diskutieren und bearbeiten lässt. Beim Online-Lernen beispielsweise dadurch, dass man zusätzliche Chat-Funktionen oder Diskussions-Tools nutzt. Die digitalen Medien und Werkzeuge spielen also eine wichtige Rolle, um konkrete Lernprozesse zu unterstützen.
Welche Bedeutung haben die Kommunikation und insbesondere die soziale Interaktion für das Gelingen und die Qualität von Lernprozessen allgemein?
Eine sehr grosse Bedeutung – in mehrfacher Hinsicht. Erstens gibt es soziale Interaktion als Lerninhalt wie z. B. Kommunikationskompetenz. Das lässt sich am besten mit Hilfe sozialer Interaktion erlernen, im Rollenspiel, in Diskussionsübungen. Zweitens hilft uns die soziale Interaktion beim Verstehen von Lerninhalten und der Wissenskonstruktion. Indem Lernende sich über ein Thema austauschen, drücken sie ihr Verständnis des jeweiligen Sachverhalts aus. Und sie hören das – möglicherweise abweichende – Verständnis desselben Sachverhalts aus der Perspektive anderer.
Schon die Transformation des eigenen Wissens in Form von Sprache oder Text fördert Lernen. Sozialer Austausch fördert zudem mögliche sozio-kognitive Konflikte zutage, wenn Lernende mit anderen Perspektiven konfrontiert sind, die von der eigenen Sichtweise abweichen. Die Auflösung dieser sozio-kognitiven Konflikte führt zu gemeinsamem Lernen. Und sogar ganz neues Wissen und vorher unbekannte Problemlösungen können so entwickelt werden.
In Präsenzsituationen ist diese Form des Lernens und Kommunizierens leichter herzustellen. Was ist anders bei der computervermittelten Kommunikation in einem Online-Format?
Der Unterschied liegt im Wesentlichen in der Verfügbarkeit sozialer Hinweisreize. In der Kommunikationspsychologie geht man davon aus, dass Menschen in Kommunikationssituationen das zwischenmenschliche Interaktionsverhalten auf zwei Ebenen interpretieren: einer Inhaltsebene und einer sozialen Ebene. Das besagt etwa die Theorie von Paul Watzlawick. Die Inhaltsebene betrifft sachliche Informationen. Die soziale Ebene betrifft die Beziehung zwischen den an der Kommunikation beteiligten Personen.
Wir alle kennen Beispiele, bei denen es uns vielleicht einmal verstört hat, wie jemand mit uns sprach, nicht was die Person gesagt hat. Dieses «wie» vermittelt sich über die sozialen Hinweisreize: Stimme, Körpersprache, Berührung, Bewegung im Raum usw. Die meisten Menschen senden und interpretieren alle diese Reize, wenn sie sozial interagieren. In Präsenzsituationen ist die Zahl der verfügbaren sozialen Hinweisreize sehr gross: Die Kommunikationspartner können – wenn es ihre individuellen Sinneskanäle erlauben – die gesamte Körpersprache, Blickkontakte, alle Tonlagen und Zwischentöne, Gerüche, Berührungen etc. ihrer Gegenüber wahrnehmen. So ordnen sie soziale Interaktion als Gesamtbild ein.
Im Unterschied dazu werden in vielen Online-Formaten Hinweisreize ausgefiltert: In Videokonferenzen, Chats, Kurznachrichten, E-Mail und Co. sind bestimmte soziale Hinweisreize nicht vollständig wahrnehmbar, etwa die Körpersprache. Dann versuchen die beteiligten Personen entweder, diese Hinweisreize mental zu ergänzen, was übrigens einen Teil der «Zoom-Fatigue» begründet. Oder es entstehen Lücken in der Einschätzung der Gesamtsituation. Das kann zu einer gewissen Unsicherheit auf der Beziehungsebene führen.
Kann das Fehlen sozialer Hinweisreize auch Vorteile bieten?
Manche Menschen, etwa sehr schüchterne Personen, kommunizieren leichter online. Sie schreiben sogar lieber eine E-Mail als direkt zu sprechen. Und in manchen sozialen Situationen kann es auch gut sein, erst Zeit zum Nachdenken zu haben, bevor man antwortet. Zum Beispiel als Kunde oder Kundin in einer Verkaufssituation. So ergeben sich online auch Spielräume, die im Präsenzgeschehen nicht so da sind. Das gilt auch für Lernsituationen. Und apropos Lernen: Darüber hinaus ist es auch eine Frage der Gewohnheit und Übung, denn wer ohnehin viel online ist, kann besser mit Online-Kommunikation umgehen als Ungeübte.
Wie lässt sich die soziale Interaktion in Online-Settings gestützt auf die computervermittelte Kommunikation ermöglichen?
Unterschiedliche digitale Medien erlauben bzw. unterdrücken unterschiedliche soziale Hinweisreize. Man spricht auch von der «Reichhaltigkeit» von Online-Settings. Diese Reichhaltigkeit hat unterschiedliche, zu erwartende Konsequenzen für die soziale Interaktion – positive wie negative. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die computervermittelte Kommunikation auch ganz neue Möglichkeiten bereitstellt. Ein Beispiel ist Virtual Reality. Hier kann man etwa Avatare einsetzen, die kreativ gestaltbar sind und manchmal eine ganz neue «Körperlichkeit» erlauben. Oder die bekannten Emoticons in Kurznachrichten und E-Mails sind ein weiteres Beispiel. Das sind kreativ gestaltbare soziale Hinweisreize in Online-Settings und speziell für Online-Kommunikation.
Soziale Interaktion in Online-Settings kann also mithilfe computervermittelter Kommunikation ermöglicht werden?
Ja, indem man gezielt prüft, welche Funktionen in welcher (Lern-)Situation wichtig sind. Ist eine gute Audioverbindung und eine besonders gute Tonqualität wichtig? Oder ist die Sichtbarkeit der Körpersprache wichtig? Ist eine kollaborative Textbearbeitung wichtig? Sind Kleingruppen besser als eine grosse Gruppe? Welcher sozialen Hinweisreize bedarf es, damit die Situation auf der sozialen Ebene eindeutig genug ist? Welche technischen Funktionen und kreativen Elemente bietet das Medium an?
Teilnehmende sagen häufig, dass sie in Online-Formaten den persönlichen Kontakt und sozialen Austausch als reduziert oder kaum möglich erleben. Gibt es neben den von Ihnen genannten kreativen Elementen weitere Möglichkeiten, um in digitalen Lern-Settings soziale Nähe herzustellen?
Meiner Erfahrung nach sind Kleingruppen wie z. B. Break-out-Gruppen in Videokonferenzen besser als Veranstaltungen im Videokonferenzplenum. Spielerische Aufwärmübungen mit Videokameras und Emoticons sind auch ein Weg. Ich würde insgesamt der Erwärmung der Gruppe viel Raum geben, etwa indem alle in einer Videokonferenz oder Virtual-Reality-Situation einmal etwas über sich selbst sagen. Die Interaktion in VR-ähnlichen 3D-Umgebungen erlaubt einen spielerischen Umgang, damit hatte ich ebenfalls positive Erfahrungen.
Und last but not least: Viel Potential liegt in den Blended-Learning-Formaten. Ich würde eine Mischform aus sich abwechselnden Online-Präsenz-Formaten empfehlen und dabei besonderen Wert auf gute Übergänge dazwischen legen, z. B. durch geeignete überleitende Aufgaben.
Gibt es Themen oder bestimmte Lernprozesse, die aufgrund der besonderen Kommunikationsmöglichkeiten nicht in Form von Online-Formaten angeboten oder durchgeführt werden sollten, wenn das Lernen in einer guten Qualität angestrebt wird?
Ganz ausschliessen würde ich das nicht, aber ich würde sagen alles, was gemeinsames körperliches Üben erfordert und/oder mit Risiken einhergeht – wie etwa Schwimmen lernen. Auch Schauspielunterricht, Tanzen, Musizieren oder auch Sicherheitsübungen können eventuell nur teilweise online ermöglicht werden.
Aus Sicht der Kommunikation: Was erachten Sie bei den Formen des hybriden Unterrichts als besonders wichtig? Was ist nötig, um die Qualität der Lernprozesse zu sichern?
Beim hybriden Unterricht ist die grosse Herausforderung die soziale Integration der im Raum befindlichen Gruppe und der zugeschalteten Teilnehmenden. Diese ist durch eine Lehrkraft allein kaum zu bewältigen. Weil es verschiedene, kognitiv sehr anspruchsvolle Tätigkeiten verbindet, die gleichzeitig durchgeführt werden müssen und das zu kognitiver Überlastung führt. Idealerweise gibt es also zwei Leitende vor Ort, die die Gruppe gemeinsam betreuen, wobei eine Leitungsperson z. B. immer für die von aussen zugeschalteten Personen den Chat moderiert und sie quasi im Raum «vertritt».
Ein partizipativer Ansatz kann ebenfalls hilfreich sein: man bittet eine Gruppe zu Beginn, die hybride Situation mitzugestalten. So verteilt sich die soziale Verantwortung im Raum auf mehrere Schultern. Kleingruppen können zugeschaltete Personen in der Präsenzsituation «mitnehmen» – im wörtlichen Sinn: beispielsweise auf dem Laptop, wo die zugeschaltete(n) Person(en) in der Videokonferenz gezeigt werden.
Welche Zielgruppen bringen die nötigen Lernvoraussetzungen für gelingende internet- oder computergestützte Lernprozesse eher mit?
Personen, die gerne lernen, neugierig und offen sind und solche, die digitale Kompetenzen erwerben möchten. Personen, die technikaffin und dabei offen sind für Neues ebenfalls. Weniger gut sind Zielgruppen mit einer geringen Fehlertoleranz und zu hoher Anspruchshaltung bzw. solche mit einem stark konsumorientierten Zugang im Sinne von: «Die Lehrkraft muss mir etwas beibringen, ich möchte mich dabei aber nicht anstrengen müssen».
Die Faktoren Flexibilität, Mitbestimmung und die Anforderungen an die (digitalen und didaktischen) Kompetenzen der Ausbildenden haben sich bei einer qualitativen Befragung des SVEB als wichtige Trends bei den Lernbedürfnissen von Teilnehmenden herausgestellt.
In welche Richtung werden sich die Lernbedürfnisse der Teilnehmenden in der näheren Zukunft entwickeln? Wagen Sie eine Prognose?
Flexibilität und Mitbestimmung bzw. Partizipation sowie digitale Kompetenzen werden meiner Meinung nach als Bedürfnisse zunehmend wichtiger werden. Und nach meiner Prognose braucht es auch insbesondere eine gute Förderung der Kreativität der Lernenden. Lernende können (und wollen häufig) selbst kreativ sein, nicht nur zuhören und zusehen. – Das aktiviert, macht Spass und fördert das Lernen. Mit digitalen Medien kann man neue kreative Tools einbinden und gestaltendes Lernen fördern, etwa mit Visualisierungen statt reinen Textprodukten.
Wie können Weiterbildungsanbieter auf die sich erweiternden und heterogenen Teilnehmendenbedürfnisse eingehen und gleichzeitig die Qualität ihrer Angebote sichern?
Ich finde die Befragung des SVEB einen guten Weg – also die Lernenden zu fragen, was sie brauchen, ist ein wichtiger Schritt. Dann ist es aber auch sicher sehr sinnvoll, die Dozierenden ebenfalls zu befragen und insbesondere deren digitale Kompetenzen und Kreativität zu stärken. Digitale Kompetenzen nicht im Hinblick auf die rein technischen Funktionen und Softwarelösungen, sondern in Bezug auf die sozio-kognitiven Funktionen digitaler Tools für die Unterstützung der Lernprozesse, die man haben möchte. Das bedarf eigener Ansätze des «Learning Designs» und ist nicht gleichzusetzen mit herkömmlichen didaktischen Fähigkeiten. Und Kreativität braucht Mut und Selbstbewusstsein – daher würde ich empfehlen, mit Dozierenden ihr Rollen(selbst)bewusstsein zu reflektieren und dieses zu stärken.
Als letzten Punkt würde ich empfehlen, dass Weiterbildungsanbieter Digitalisierungsstrategien entwickeln sollten, die nicht an der rein technischen Infrastruktur verbleiben, sondern die Digitalisierung als Prozess, der Menschen und die Organisation verändert, begreifen. Dieser Prozess wird nicht notwendigerweise durch digitale Technologien mitbestimmt. Er ist gut gestaltbar, wenn man ganzheitliche Strategien und Ziele dazu entwickelt.
Interview: Ueli Bürgi
Zur Person:
Prof. Dr. Carmen Zahn ist seit 2011 Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der FHNW Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten. Sie studierte Psychologie und Medienwissenschaften. An der FHNW forscht und lehrt sie zu den Themen Digitale Medien, Kooperation, Wissen und Lernen.
Bild: Prof. Dr. Carmen Zahn