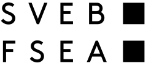Mit dem Programm «Netzwerk Europa» unterstützt der SVEB Organisationen der Weiterbildung dabei, internationale Kooperationsprojekte zu akquirieren und durchzuführen. Damian Fäh nahm mit den Flying Teachers am Programm teil. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen.
Interview: Saambavi Poopalapillai
Wie kam es bei Ihnen in der Institution zum Entscheid, am Programm «Netzwerk Europa» mitzumachen?
Durch frühere Teilnahmen an internationalen Konferenzen wurde uns bewusst, dass Institutionen der EU die gleichen Themen beschäftigten wie uns. In gewissen Bereichen ist die Professionalisierung schon deutlich weiter fortgeschritten als in der Schweiz, so zum Beispiel in der Förderung der Grundkompetenzen. An den Konferenzen wurden auch Produkte (wie MOOCs, Leitfäden, Toolkits etc.) aus EU-Projekten vorgestellt, die uns in ihrer Qualität und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Praxis überzeugt haben. Das Potential für die Professionalisierung war offensichtlich.
Was geschah dann?
Für Flying Teachers war aufgrund dieser Erfahrung schnell klar, dass wir uns international besser vernetzen und vermehrt den professionellen Austausch mit Institutionen aus der EU suchen wollten. In diesem Zusammenhang fühlte sich die Anfrage des SVEB, ob wir beim Programm «Netzwerk Europa» mitmachen wollten, wie ein glücklicher Zufall an. Auch wenn wir damals noch nicht wirklich abschätzen konnten, welche Chancen und Herausforderungen die Teilnahme am Netzwerk mit sich bringen würde, mussten wir nicht lange abwägen und verpflichteten uns zur Eingabe mehrerer Projekte.
Mit welcher Motivation haben Sie am Programm «Netzwerk Europa» teilgenommen?
An europäischen Kooperationsprojekten teilzunehmen, bot uns die Möglichkeit, nicht nur passiv, via Konferenzteilnahmen, vom internationalen Know-How zu profitieren, sondern aktiv an der Entwicklung neuer Ressourcen mitzuarbeiten und diese auch gezielter auf unsere spezifischen Bedürfnisse auszurichten – und unser eigenes Know-How aus der Praxis im Projekt einzubringen. Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung zum Mitmachen war die Finanzierung der Projektanträge durch das Netzwerk. Dies erlaubte uns, es einfach mal zu versuchen, mit der Sicherheit, dass die Kosten für die anfallende Arbeit gedeckt waren – unabhängig vom Erfolg der Projekteingabe.
Im Januar 2023 waren Sie an einem Networking Anlass in Zagreb. Konnten Sie dabei erste Projektzusagen erarbeiten?
Der Networking-Anlass fand mitten im Prozess der Partnersuche via Netzwerke und Partner-Such-Webseiten statt. Durch die Teilnahme wurden uns einige Dinge klar: Viele Institutionen sind in dutzenden Projekten gleichzeitig aktiv und bestreiten teilweise ihre gesamte Finanzierung durch EU-Projekte. Für diese Institutionen sind Projekte das Daily Business. Für diese Bildungsorganisationen sind vor allem zwei Dinge wichtig: Bei möglichst vielen Projekten mitmachen und möglichst wenig Zeit investieren, um Projektpartner zu finden. Diese Erfahrung hat uns dazu gebracht, unsere Strategie anzupassen, weniger rigide an unseren ursprünglichen Ideen festzuhalten und das Feld potenzieller Partner-Institutionen weiter abzustecken. Mit Erfolg, denn am Ende wurden wir in zwei Projekten einer Institution, die in Zagreb teilgenommen hatte, als Partner aufgenommen.
Sie haben am Schluss mehrere Anträge eingereicht. Was sehen Sie im Nachhinein als grösste Herausforderung?
Am Ende konnten wir vier Anträge bei Movetia, der Schweizer Nationalagentur einreichen. Alle vier waren thematisch weit weg von unseren ursprünglichen Ideen – aber dennoch für unsere Institution und die Schweizer Bildungslandschaft relevant und wertvoll. Die weitaus grösste Herausforderung war das Finden von Projektkonsortien, die uns als Partner aufgenommen haben. Der zeitliche Aufwand dafür war mehr als doppelt so gross wie das Schreiben der Anträge für Movetia. Die grössere Herausforderung war aber mental: Wenn man nach langer Suche passender Institutionen dann endlich mal einige von ihnen anschreibt, und dann fast nur Absagen bekommt – sofern überhaupt reagiert wird – stellt sich schon eine gewisse Frustration ein und der Durchhaltewille wird ernsthaft auf die Probe gestellt. Zwischendurch fragten wir uns auch, ob wir vielleicht gewisse ungeschriebenen Spielregeln nicht kennen, und deshalb keine Zusagen bekommen. Und tatsächlich war es wohl so, dass die wenigsten Konsortien mit Institutionen arbeiten wollen, die neu in der Landschaft auftauchen, und die sie nicht kennen. Dies zeigt sich dann auch darin, wie wir zu unseren Projekten gekommen sind: Durch persönlichen Kontakt, durch Empfehlung durch frühere Partner und durch einen Kontakt in einem Netzwerk, bei dem wir schon vor der Projektsuche Mitglied waren.
Was empfehlen Sie Institutionen, die sich derzeit noch überlegen, am Programm «Netzwerk Europa» mitzumachen?
Der Aufwand für den Netzwerkaufbau sollte nicht unterschätzt werden. Potentielle Partner zu identifizieren ist eines – Partner zu finden, die einem in ein Projektkonsortium aufnehmen, dann nochmals deutlich schwieriger. Daher empfehle ich, wo immer möglich, Institutionen anzusprechen, zu denen man bereits eine Verbindung hat – aus einem anderen Netzwerk, von einer Konferenzteilnahme – oder bei der man von einer dritten Organisation empfohlen werden kann. Ich empfehle auch unbedingt, an einem Netzwerkanlass zur Projektgenerierung teilzunehmen: Gerade, wenn man neu in der EU-Projektlandschaft ist, kann der Aufbau eines persönlichen Kontakts ein ansonsten fest verschlossenes Tor öffnen.