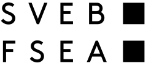Die Studie «Subjektive Sichtweisen auf Grundkompetenzen: Gründe für eine Nicht-Teilnahme an Angeboten» des SVEB ging mit qualitativen Interviews der Frage nach, warum Menschen mit geringen Grundkompetenzen keine Weiterbildung besuchen. Projektverantwortliche Helen Buchs erklärt, wie die Ergebnisse zu werten sind und wie das Weiterbildungsfeld darauf reagieren könnte.
Was war der Ausgangspunkt der Studie? Beziehungsweise: Was war bekannt?
Bekannt war, dass in der Schweiz knapp ein Drittel der Erwachsenen Mühe mit Grundkompetenzen hat. Diese Personen nehmen seltener an Weiterbildung teil als solche, die höhere Kompetenzniveaus aufweisen. Einiges war auch über die Gründe für die verbreitete Nicht-Teilnahme bekannt. Nämlich, dass Hürden wie Zeitmangel, gesundheitliche Probleme oder geringe finanzielle Mittel eine wichtige Rolle spielen. Zudem hatten Forschung und Praxis darauf hingewiesen, dass subjektive Gründe, die auf Erfahrungen und Deutungen der Betroffenen beruhen, mindestens ebenso wichtig sind.
Was sind die neuen Erkenntnisse aus der Studie?
Die Studie liefert nun tiefere Einsicht in subjektive Begründungen für eine Nicht-Teilnahme. Sie zeigt, dass Entscheidungen gegen Weiterbildung aus Sicht der Betroffenen nachvollziehbar sind. Sie haben funktionierende Bewältigungsstrategien entwickelt, mit denen sie ihren Alltag trotz geringer Grundkompetenzen meistern. Viele vermeiden strukturierte Lernkontexte bewusst, da sie in ihrer Bildungsbiografie negative Erfahrungen gemacht haben. Häufig bestehen zudem verinnerlichte Defizitzuschreibungen, die das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit untergraben. Neu ist dabei insbesondere die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Erwartungen die subjektiven Begründungen für eine Nichtteilnahme beeinflussen. Die Betroffenen spüren deutlich, dass es eine gesellschaftlich anerkannte Norm dafür gibt, wie man lesen, schreiben oder rechnen können sollte. Viele empfinden den manchmal offensichtlichen, aber oft auch subtilen Anpassungsdruck an diese sogenannte «dominante Literalität» als belastend. Nicht-Teilnahme an Weiterbildung ist damit nicht bloss ein «Desinteresse», sondern oft auch ein Widerstand gegen diese normativen Anforderungen.
Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen?
Die Ergebnisse verweisen auf ein Spannungsfeld: Einerseits wünschen sich viele Betroffene eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und sind auch bereit, durch Lernbemühungen ihre Grundkompetenzen zu verbessern. Andererseits erleben sie gesellschaftliche Erwartungen an Grundkompetenzen als Druck oder Stigmatisierung, den sie sich nicht zusätzlich durch die Teilnahme an einem Lernangebot aussetzen wollen – insbesondere, weil ihr Alltag auch ohne funktioniert und klassische Bildungsformate häufig mit negativen Erfahrungen behaftet sind. Daraus lässt sich schliessen, dass es nicht nur darum geht, die Betroffenen zu unterstützen, ihre Grundkompetenzen zu verbessern. Entscheidend ist, wie das geschehen kann. Dabei müssen auch Angebote, Förderlogiken und gesellschaftliche Normen hinterfragt werden.
Wie hat das Weiterbildungsfeld darauf zu reagieren?
Das Weiterbildungsfeld kann dazu beitragen, dass Lernen nicht mit Anpassungsdruck assoziiert wird. Dabei wirken abstrakte Bildungsziele kaum motivierend. Lernangebote müssen so gestaltet sein, dass sie subjektiv als sinnvoll, zugänglich und lohnend erscheinen. Es braucht also lebensweltlich anschlussfähige Angebote. Zudem braucht es eine diversifizierte Angebotslandschaft, welche die Heterogenität der Zielgruppe widerspiegelt.
Was hiesse es konkret, Angebote den Lebenswelten der potenziellen Teilnehmenden anzupassen?
Lebensweltliche Passung bedeutet, Angebote nicht abstrakt, sondern entlang realer Alltagsprobleme und Handlungsbedarfe zu gestalten. Das kann heissen, dass beispielsweise digitale Tools, familiäre Verpflichtungen oder Herausforderungen im Arbeitsleben gezielt als Lernanlässe aufgegriffen werden. Weiterbildungsangebote sollten bewusst auf eine Sprache ohne Defizitzuschreibung setzen, vorhandene Potenziale anerkennen und subjektiv wahrgenommene Relevanz in den Mittelpunkt stellen. Die Zugänglichkeit muss durch niederschwellige Zugänge und partizipative Angebotsentwicklung verbessert werden. Darüber hinaus können neutrale Anlaufstellen, informelle Lerngelegenheiten und flexible Formate Brücken bauen.
Inwiefern ist auch die Gesellschaft gefordert?
Die Studie zeigt deutlich: Die gesellschaftliche Vorstellung davon, was «legitime» Literalität ist, wirkt ausgrenzend. Sie erzeugt ein Bild von «Defizit», dem viele nicht entsprechen können oder wollen. Gesellschaftlich ist deshalb ein Perspektivwechsel notwendig: Grundkompetenzen sollten nicht nur funktional, sondern auch biografisch und kontextuell verstanden werden. Es braucht eine Reflexion darüber, wer durch bestimmte Erwartungen ausgeschlossen wird.